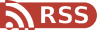Sieben zu drei
Heute ist Europawahl. Für mich ist sie eine Jubiläumswahl: Die erste Wahl, an der ich kurz nach Erreichen der Volljährigkeit teilnehmen durfte, war vor vierzig Jahren die Europawahl 1984. Ich erinnere mich gut: Wenige Tage vor der Wahl starb in Italien Enrico Berlinguer, und die Kommunisten wurden stärkste Partei. Die Welt hat sich seither enorm verändert. Umso mehr freut mich heute die Möglichkeit, Fabio De Masi ins EU-Parlament zu wählen, der etwas vom Geist der alten italienischen sinistra popolare bewahrt hat. Als Bundestagsabgeordneter und Geldwäsche-Aufklärer hat er sich parteiübergreifenden Respekt erworben. Aber die Partei, für die er jetzt antritt, polarisiert. Nachfolgend einige Überlegungen und Thesen zum Bündnis Sahra Wagenknecht.
Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Im Chinesischen kennt man die Redewendung qī fēn sān fēn, »sieben zu drei«, um auszudrücken, dass bei einem ambivalenten Sachverhalt unterm Strich eher das Positive überwiegt. Mao Zedong wendete diese Formel auf Stalin an, und später sagte Deng Xiaoping dasselbe über Mao, nicht ohne hinzuzufügen, dass er selbst schon mit einer Bewertung »halb und halb« zufrieden wäre. Bei Sahra Wagenknecht, die in jungen Jahren Stalin ähnlich beurteilte wie vormals Mao, haben wir allerdings nicht die politische Bilanz einer verstorbenen Persönlichkeit zu ziehen, sondern wir können nur einen Zwischenstand einschätzen: Seit dreißig Jahren ist sie in Politik und Medien präsent. Ihre Wandlung von der faszinierend exotisch anmutenden intellektuellen Frontfrau der Kommunistischen Plattform zur Volkstribunin der frustrierten Mittelschicht hat ihren vorläufigen Kulminationspunkt in der Gründung einer eigenen Partei erreicht, die ein reelles Potenzial hat, bei den nächsten Wahlen in Ländern und Bund die politische Konstellation zu verändern. Ob dieses Konglomerat aus linken Linken und rechten Sozialdemokraten, die jetzt alle behaupten, »links« und »rechts« gelte nicht mehr, allerdings mehr als ein Strohfeuer sein wird, ob es sich dauerhaft als neuartige »linkskonservative« Kraft etablieren kann, ist zur Stunde noch nicht absehbar. Es handelt sich um ein Experiment, dem eine Rechnung mit vielen Unbekannten zugrunde liegt. Dass Sahra Wagenknecht dieses Experiment wagt, ist in Abwägung aller Faktoren als positiv zu bewerten, auch wenn es – unvermeidlich – mit vielen Widersprüchen und Ambivalenzen einhergeht und manchen nicht unerheblichen Einwänden standhalten muss. Daraus ergibt sich ein Plädoyer für eine kritische Unterstützung.
Welthistorisches Individuum trifft auf Repräsentationslücke
Dass die hochbegabte introvertierte Einzelgängerin Sahra Wagenknecht zu einer politischen Schlüsselfigur wurde, ist an sich eine außergewöhnliche Leistung. Wenn sie heute gegen abgehobene Eliten zu Felde zieht, liegt darin eine gewisse Pikanterie, wenn man bedenkt, dass ihr geistiger Ziehvater Peter Hacks, kolossal begnadeter Dichter und weltfremder Salonstalinist, in puncto elitärer Abgehobenheit schwerlich zu übertreffen war. Ein geistiges Universum mit den Fixsternen Hegel und Marx, Goethe und Hacks scheint auf den ersten Blick keine gute Ausgangsbasis für eine Karriere im Politikbetrieb zu sein.
Schon habituell schien Sahra in linke Milieus nie so recht zu passen. Ihre Individuiertheit und geistige Unabhängigkeit versetzte sie jedoch in die Lage, aus überkommenen Denkschemata des eigenen politischen Lagers auszubrechen und so die politische Repräsentationslücke zu besetzen, die sich seit der Jahrhundertwende aufgetan hat. Sie trägt Züge jener »welthistorischen Individuen«, von denen Hegel in einem berühmten Abschnitt seiner Einleitung zur Philosophie der Geschichte spricht: Das sind Individuen, in deren subjektiven Zwecksetzungen Allgemeines zur Geltung kommt, »was not und was an der Zeit ist«1, die mit ihrem Ausscheren aus gegebenen Normen einer historischen Tendenz zum Durchbruch verhelfen. Von Idiosynkrasie geleitet, hat Sahra etwas ins Dasein gebracht, was in der politischen Kultur Deutschlands bislang undenkbar war: eine politische Kraft, die ohne kulturlinke Avantgardeansprüche den sozialen Zielsetzungen und – nota bene – dem rationalen Anspruch der traditionellen Linken verpflichtet und zugleich kommunitaristisch und pragmatisch orientiert ist.
Dass Sahras Partei sich die »Vernunft« auf die Fahnen schreibt, entbehrt natürlich nicht der Ironie.2 Natürlich weiß Sahra, dass das eine strategisch motivierte Leerformel ist: Sie kennt ihren Hegel gut genug, um zu wissen, dass Vernunft sich in der Geschichte nicht durch den Beschluss »Jetzt wollen wir mal vernünftig sein« realisiert, sondern sich irrational anmutender Triebkräfte bedient. Nicht um subjektive, um die objektive Vernunft geht es. Vor allem gilt in Bezug auf die Protagonistin exakt Hegels Feststellung: »Ein welthistorisches Individuum hat nicht die Nüchternheit, dies und jenes zu wollen, viel Rücksichten zu nehmen, sondern es gehört ganz rücksichtslos dem einen Zwecke an. So ist es auch der Fall, daß sie andere große, ja heilige Interessen leichtsinnig behandeln, welches Benehmen sich freilich dem moralischen Tadel unterwirft.«3 So ist es: Vieles an ihren Äußerungen der letzten Jahre mutet grenzwertig, manchmal auch abwegig an. Ihren Newsletter habe ich abbestellt, als sie anfing, sich als Impfstoff-Expertin aufzuführen. Ich hatte auch nie den Eindruck, dass ich mich fast dafür entschuldigen müsse, weiß, männlich und heterosexuell zu sein, und ich bin nicht der Meinung, dass ein Genderverbot in öffentlichen Einrichtungen eine angemessene Reaktion auf die um sich greifende sprachliche wokeness wäre. Aber ich kenne meinen und Sahras Hegel gut genug, um solche Zuspitzungen kontextualisieren zu können. Es sind strategische Einsätze im Bemühen, in heillos verzerrte öffentliche Debatten korrigierend einzugreifen, denen wiederum korrigierend zu widersprechen ist: Sahras Sache wäre gewiss nicht gut gedient, wenn man ihr in allen Einzelheiten das letzte Wort überließe. Die Erfolgschancen ihres Projekts hängen davon ab, ob es gelingt, den organisatorischen Rahmen für einen vernünftigen Streit über Maß und Bestimmung von Kämpfen um den Ausweg aus unserer gesellschaftlichen Schieflage zu gestalten.
Von der Kaderpartei zur Volkspartei
Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist momentan eine Kaderpartei. Mit der KPD der Weimarer Republik hat es gemeinsam die Probezeit für neue Mitglieder und Sahras Neuauflage der Sozialfaschismustheorie mit den Grünen als Hauptfeind. Wie man hört, stößt die strenge Überprüfung von Beitrittskandidaten auf Unmut, sowohl bei übertrittswilligen Linkspartei-Mitgliedern, die zum »Wagenknecht-Lager« gehörten und jetzt enttäuscht sind, dass man sie nicht oder nicht sofort haben will, während FDPler aufgenommen werden, als auch bei Interessierten ohne politische Vorgeschichte, die nicht verstehen, warum nicht blindlings jeder, der Sahra toll findet, erwünscht ist. Die Gefahr einer Unterwanderung durch Rechte, Querfrontler und Verschwörungstheoretiker scheint, einer Mitteilung der Ko-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali zufolge, real zu sein. Nicht thematisiert wird, woher diese Gefahr kommt. Dabei ist die Erklärung sehr einfach: Die gute Sahra hat jahrelang einem ideologisch eher rechtsdrehenden Kleinbürgerpublikum den Bauch gepinselt. Sie will Wähler der AfD abwerben, nicht aber deren Mitglieder. Sie braucht sie an der Wahlurne, nicht in der Partei. Bei allem Populismus in der Außendarstellung steht jedoch außer Zweifel, dass das BSW intern keineswegs wie ein Stammtisch funktioniert, sondern strengste geistige Disziplin übt: Alles, was die Protagonistin an polarisierenden Thesen äußert, ist natürlich sorgfältig kalkuliert. Sie beherrscht das Spiel mit Ambivalenzen und weiß genau, wie weit sie gehen darf, ohne die eigene sei es linke, sei es »vernünftige« Integrität aufs Spiel zu setzen. Hier darf es zu keinem Kontrollverlust kommen.4 Insofern hat der rechtskonservative Autor Klaus-Rüdiger Mai, Wagenknecht-Bewunderer und -Verächter in einer Person, sicher nicht gänzlich Unrecht mit der seiner unfreiwillig komischen Monographie »Die Kommunistin« zugrunde liegenden These, dass Sahra Wagenknecht ungeachtet aller Wandlungen ihrer Positionen doch ihrer marxistischen und leninistischen Denkschule treu bleibt. Selbstverständlich ist für sie ein Parteiprogramm kein Sammelsurium aus tagespolitischen Interessen und Forderungen, sondern grundiert in Gesellschaftstheorie und, ja, Klassenanalyse. Damit ist allerdings ein Spannungsverhältnis vorgezeichnet zwischen Parteimitgliedern, die über eine solche theoretische Schulung altlinker Provenienz verfügen, und denen, deren Sympathie für Sahras Programm auf bürgerlichen Interessen oder einfach auf »Bauchgefühl« beruht.
In der Linkspartei war der letzte Versuch des »Wagenknecht-Lagers«, das Ruder herumzureißen und die Degeneration zur grünaffinen Bewegungspartei für gebildete urbane Aktivistenmilieus zu stoppen, vor zwei Jahren der Aufruf »Für eine populäre Linke«5, Erstunterzeichnerin: Amira Mohamed Ali, Sahra stand diskret auf Platz 7 der Liste. Mit seinem klassisch-»altlinken« Inhalt fand er 6500 Unterstützer. Im Text war die Rede vom Kampf gegen kapitalistische Herrschaft, von gemeinsamen Klasseninteressen und dem Ziel eines demokratischen und ökologischen Sozialismus – Themen, zu denen man von Sahra schon lange nichts mehr gehört hat und mit Sicherheit auch nichts mehr hören wird. Einige der prominenten Unterzeichner auf den oberen Plätzen sind heute beim BSW, aber die Mehrheit des »linkspopulären« Flügels ist in der Linkspartei geblieben: Man weiß zwar, dass man auf dem sinkenden Schiff auf verlorenem Posten steht, aber man weiß dort wenigstens, woran man ist, und schreckt davor zurück, sich auf ein die gewohnten linken Geleise verlassendes Experiment mit ungewissem Ausgang einzulassen. Das Problem ist: Innerhalb der Linkspartei hat das hauptsächlich um die Strömung Sozialistische Linke gruppierte linkspopuläre Lager keine reelle Chance auf Durchsetzung seiner Positionen mehr, und der Absturz der Partei in die Bedeutungslosigkeit wird nicht aufzuhalten sein. Auch eine Abspaltung einer klassisch sozialistischen Partei linkspopulärer Ausrichtung hätte keine Erfolgsaussichten: Dafür besteht in Deutschland keine ausreichende gesellschaftliche Nachfrage, sie würde flächendeckend an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Sahra Wagenknechts breiter angelegtes Projekt verdankt sich dieser Einsicht. Gegen die Bedenken derjenigen, die am BSW das linke Profil und die sozialistische Perspektive vermissen, hat der Gewerkschafter Ralf Krämer, dessen politischer Weg von der SPD über WASG und LINKE zum BSW führte, darauf hingewiesen, dass auch die WASG vor zwanzig Jahren nicht mit einem linken oder gar sozialistischen Selbstverständnis antrat und dennoch entscheidende Impulse linker Politik in Deutschland gesetzt hat.
Dass das maßgebende Personal des BSW bislang hauptsächlich aus der Linkspartei stammt, führt bei manchen von Sahras Verehrern allerdings zu Skepsis und Unmut. Dass Funktionäre, die vor zwei Jahren noch einen ganz altlinken Aufruf im Geiste von Klassenkampf und Sozialismus unterzeichnet haben, jetzt plötzlich nicht mehr links sein wollen und sich mit Überläufern aus der SPD, die eher vom rechten als vom linken Flügel kommen, und Quereinsteigern aus der Wirtschaft vom millionenschweren IT-Unternehmer bis zum selbsternannten Bäckermeister aus Merzig zusammentun, ist in der Tat erklärungsbedürftig. Schon im jetzigen, überschaubaren Kaderapparat gibt es Widersprüche: Da gibt es Aktivisten mit Hintergrund aus der WASG, die sich aus der Opposition gegen die Hartz-Gesetze formierte; der prominenteste WASG-Veteran ist mit Sahra verheiratet, ein anderer baut den Landesverband Bayern auf, und es gibt etliche von ihnen an der Basis. Andererseits gibt es den schwäbisch-protestantischen ehemaligen Oberbürgermeister, der noch gegen Ende seiner SPD-Karriere die Agenda 2010 vehement verteidigte, und selbst ostdeutsche Linkspartei-Realos outen sich nach dem Übertritt zum BSW auf einmal als Befürworter des Hartz-IV-Sanktionsregimes.6 Die Einbindung von Bürgerlichen und rechten Sozialdemokraten dient zweifellos insbesondere dem Zweck, eine breite Einheitsfront in friedenspolitischen Fragen herzustellen7; divergierende Klasseninteressen werden sich damit aber nicht überbrücken lassen. Dass als Ko-Vorsitzende Amira Mohamed Ali fungiert, liegt nahe: Sie ist erst spät in die Politik eingestiegen, ohne – nach eigenem Bekunden – über eine klassische linke politische Bildung zu verfügen, von daher erscheint sie »formbar«. Aber sie hat sich der Frage stellen müssen, was sie binnen kurzer Zeit in puncto Migrationspolitik zu einem Schwenk um 180 Grad veranlasste, und ihre Antworten fallen wenig plausibel aus. Solche Wendungen finden wir auch bei anderen aus der Linkspartei kommenden Funktionären. So waren die im Parteivorstand und auf der Europawahlliste präsenten Schwestern Friederike und Judith Benda noch vor ein paar Jahren dafür bekannt, dass sie in Berlin mit Engagement in Sachen Antirassismus oder Queer-Themen die LINKE just für die Zielgruppe attraktiv gemacht haben, die Sahra zur »Lifestyle-Linken« zählt.8 Daraus ist ihnen kein Vorwurf zu machen: Es ist völlig legitim, dazuzulernen und Positionen und Prioritäten zu verändern. Es irritiert bloß, wenn das ohne jede Erklärung geschieht.
Schon in der jetzigen Konstellation fallen – erfreulicherweise – Schattierungen auf: Zwar folgen die aus der Linken kommenden Kader alle den Vorgaben der Chefin und üben fleißig Sahrasprech, aber doch mit spürbar unterschiedlichen Akzenten und Zungenschlägen. Ein Fabio De Masi trägt die Inhalte der Großen Vorsitzenden einerseits mit der nötigen Beherztheit, an anderer Stelle aber weniger schrill, viel besonnener und differenzierter vor und spielt damit zweifellos eine Schlüsselrolle für die Gewinnung linker Sympathisanten. Es ist tatsächlich ein bisschen wie früher in den kommunistischen Parteien, wo hinter der nach außen zur Schau getragenen Einheit und Geschlossenheit Meinungsverschiedenheiten an Nuancen der Formulierung erkennbar waren. So überrascht es nicht, wenn man im Gespräch mit Insidern erfährt, dass manche von Sahras Positionen intern keineswegs unumstritten sind.
Dauerhaft etablieren können wird sich das BSW, wie auch immer es zukünftig heißen mag, nur als gesellschaftlich verankerte und breit aufgestellte Mitgliederpartei: Man will eine Volkspartei werden. Wie deren Zusammensetzung in Zukunft aussehen wird, steht in den Sternen. Aber sicher ist: Wie in jeder demokratischen Partei wird es verschiedene Strömungen und dementsprechend kontroverse Diskussionen geben. Das gilt umso mehr, als man schlecht die Verengung des Meinungskorridors in anderen Parteien beklagen und gleichzeitig in der eigenen, die es besser machen will, Dissens unterdrücken kann. In einer der »Vernunft« verpflichteten Partei wird man kaum unwidersprochen die Linie durchhalten können, dem Klimawandel sei allein mit innovativer Technologie ohne Veränderungen der Lebensweise beizukommen. Die Entwicklung eines ökologischen Profils steht noch aus.9 Man wolle nicht »Linke 2.0« sein, sagt Sahra. Kontinuität zeichnet sich aber im Hinblick auf ein Übergewicht des Ostens in der Wählerschaft ab. Ob die Basis einer Volkspartei sich in Westdeutschland mit Sticheleien gegen »skurrile Minderheiten« schaffen lässt oder mit einem Seeheimer Kreis für Russlandfreunde, kann bezweifelt werden. Offen bleibt die Frage nach einem Programm, das eine attraktive Perspektive eines solidarischen Zusammenlebens umreißt.
Demokratische Parteien stützen sich auf programmatische Grundideen und Leitbilder, die für unterschiedliche Ausgestaltungen offen sind. Die Frage lautet: Was ist der Grundkonsens, der die raison d’être dieser Partei ausmacht, welche divergierenden Interpretationen können sich daraus ergeben, und wie lassen diese sich zu einer handlungsfähigen Einheit der Gegensätze bündeln? Und spezieller: Welche Möglichkeiten der Mitgestaltung könnten sich für uns »Altlinke« in diesem Kontext eröffnen?
Klassenkampf und überdeterminierter Widerspruch
In meiner Stadt plakatierte die LINKE zur Europawahl: »Endlich wieder Klassenkampf!« Gegen Sahra wird in linken Kreisen der Vorwurf erhoben, sie habe den Klassenkampf aufgegeben und durch eine populistische Strategie des Standort-Nationalismus und der Elitenschelte ersetzt. Tatsächlich hat sie, wenn man ihre programmatischen Äußerungen für bare Münze nimmt, schon vor mehr als zehn Jahren ihren alten marxistischen Bezugsrahmen verlassen zugunsten eines von links reinterpretierten Ordoliberalismus mit Mittelstandsromantik und Fordismus-Nostalgie. Arbeiterbewegung kommt in ihrem letzten Buch »Die Selbstgerechten« nur in der Form vor, die Robert Kurz »verhausschweint« nannte. Dass Sahras Marxismus immer jener empiristisch-historizistische »einfache Marxismus« (Michael Wendl) war, der die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie nur verkürzt wahrnahm und sein Kapital als eine Art bessere Volkswirtschaftslehre fehlinterpretierte, erleichterte einen gleitenden Übergang.
Der linke Vorwurf des Verrats am Marxismus ist allerdings kurzsichtig. Wer ihn erhebt, müsste sich zumindest fragen, wieso denn die wesentlichen Beiträge zur Klassenanalyse der gegenwärtigen westlichen Gesellschaften, die nicht in formelle Abstraktionen münden, sondern jene konkrete Analyse der konkreten Situation liefern, die ein bekannter russischer Revolutionär gefordert hat, nicht von ausgewiesenen Marxisten stammen. Dabei steht der deutsche Soziologe Andreas Reckwitz10 (ein Linksliberaler, der zur eigenen Klassenlage genug professionelle Distanz aufbringt, um ihren gesellschaftlichen Zusammenhang zu durchschauen) keineswegs allein mit seinem Befund, dass das Kernproblem mit der Verfasstheit der Mittelschicht zusammenhängt; in den USA sind so verschiedene Theoretiker wie der eher konservative Joel Kotkin und die Linksintellektuelle Catherine Liu zu ganz ähnlichen Resultaten gelangt.
Die Konsolidierung des Kapitalismus nach dem Zweiten Weltkrieg führte zur Herausbildung einer breiten Mittelschicht, vor allem durch Aufstieg aus der Arbeiterschaft. Menschen, die in Städten wie auf dem Land in der Industrie, im Handwerk, im Handel und Finanzsektor arbeiten, von Beruf Ingenieur, Schreinermeister oder Sparkassenfilialleiter sind, galten über Jahrzehnte als tragende Säule der Gesellschaft. Ihre politische Vertretung waren die konservativen und sozialdemokratischen Volksparteien. Ihr Wertesystem gründet in einem Interesse an Stabilität, sozialer Sicherheit und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Diese alte Mittelschicht existiert nach wie vor. Sie ist in den letzten dreißig Jahren jedoch ins Abseits gedrängt worden durch die Entstehung einer neuen Mittelschicht, Reckwitz spricht ausdrücklich von »neuer Mittelklasse«, als Resultat von Prozessen der Globalisierung und technischen Innovation. Die neue Mittelschicht besteht wie die alte hauptsächlich aus Angestellten, formell also abhängig Beschäftigten, aber sie ist im Bereich der »Wissensökonomie« angesiedelt: in Informationstechnologie, Wissenschaft, Nichtregierungsorganisationen, Bildungswesen, Medien und Kultur – im globalisierten ökonomisch-politisch-kulturellen Komplex. Während die Arbeit der alten Mittelschicht in weiten Teilen Routine beinhaltet, zeichnet sich die der neuen Mittelschichtler durch Selbstbestimmung und Kreativität aus: Auch wenn es sich objektiv um Lohnarbeit handelt, erscheint deren »entfremdeter« Charakter aufgehoben. Sie sind in der Regel Akademiker, die in Großstädten leben und dort Gentrifizierungsprozesse vorantreiben. Bedingung ihres Erfolgs ist ein hohes Maß an Mobilität und Flexibilität. Ihr Wertesystem ist hochgradig individualistisch und kosmopolitisch, im Zentrum stehen »Selbstbestimmung«, »Selbstverwirklichung«, »Diversität« und der Primat globaler Themen. Alle Arten von Entgrenzung werden begrüßt, Migration und europäische Integration sind uneingeschränkt positiv besetzt. Unerschütterlich ist in diesen Kreisen der Glaube an die eigene geistige und moralische Überlegenheit. Wo die eigene Lebensform als die universell einzig wahre gilt, besteht eine entsprechend hohe Bereitschaft, diese auch durch militärischen Interventionismus durchzusetzen. Ökonomisch ist diese neue Mittelschicht relativ, aber nicht unbedingt übermäßig privilegiert: Eine starke Abhängigkeit von öffentlichen Sektoren und Aufträgen sowie die vielen prekären Beschäftigungsverhältnisse im akademischen Bereich begünstigen eine umverteilungsfreundliche Einstellung, die sich in der liberal-individualistischen Grundhaltung kompatiblen Konzepten wie »bedingungsloses Grundeinkommen« niederschlägt, während die klassische, auf kollektive Bedürfnisse von Lohnabhängigen zugeschnittene Sozialstaatlichkeit eher in Zweifel gezogen wird. Ihre zentrale Stellung im Sektor der Wissensproduktion und ihr kulturelles Kapital machen die neue Mittelschicht zur handlungsfähigen Klasse. Ihre typische politische Repräsentanz sind die Grünen, aber auch auf alle anderen etablierten Parteien bis in den liberal-konservativen Sektor hinein hat ihr Wertesystem mehr oder weniger stark abgefärbt, mit dem Ergebnis, dass politische Entscheidungen von Merkels »Willkommenskultur« bis zu Habecks Heizungsgesetz ohne vorgängige Abwägung der Folgen für weniger privilegierte Bevölkerungsteile getroffen werden. Im politischen und medialen Diskurs hat die neue Mittelklasse die Oberhand gewonnen. Mit den Vorgaben ihres Wertesystems konfligierende Meinungen werden ausgegrenzt und stigmatisiert. In diesem Sinne ist die neue Mittelklasse inzwischen die dominante Fraktion der herrschenden Klasse.
In Frankreich mit seinen seit jeher ausgesprochen elitären Strukturen sprach Pierre Bourdieu im Dezember 1995 in einer Rede vor streikenden Eisenbahnern pointiert vom »Staats-Adel«, der sich auf die Autorität der »Wissenschaft« und akademischer Titel beruft und sich im Selbstverständnis als »aufgeklärte« Elite über die vermeinte Kurzsichtigkeit des gemeinen Volkes erhebt. Das, so führte Bourdieu damals aus, war immer charakteristisch für reaktionäres Denken; aber unter neoliberalen Vorzeichen besteht dessen neue Qualität darin, dass die Regierenden, die Chefs und »Experten« im Namen von »Vernunft und Moderne«, »Bewegung und Veränderung« gegen »Unvernunft und Archaismus, Trägheit und Konservatismus auf der Seite des Volkes, der Gewerkschaften, der kritischen Intellektuellen« agitieren.11 Bourdieu griff damit sowohl die konservative technokratische Elite an (der Gaullist Alain Juppé hatte als Regierungschef eine neoliberale Reform der staatlichen Bahn in Angriff genommen) als auch diejenigen Linken, die zu der Ansicht gelangt waren, marktliberale Strukturreformen seien ein unumgängliches Gebot der »Vernunft« (der renommierte linksliberale Philosoph Paul Ricœur hatte sich in diesem Sinne geäußert). Natürlich wurde er des »Populismus« bezichtigt.
Heute, drei Jahrzehnte später, ist die linksliberale neue Mittelklasse selbst wesentlicher Bestandteil des von Bourdieu attackierten »Staats-Adels« geworden. Zur alten wirtschaftsliberalen Elite steht sie in einem Verhältnis sowohl der Konkurrenz als auch der Kooperation. Die private Profitwirtschaft alten Stils und die stärker auf öffentliche Zuwendungen angewiesene Wissensökonomie haben einerseits gegensätzliche Interessen, andererseits gibt es Überlappungen, die zur Herausbildung dessen führen, was der katholisch-konservative amerikanische Publizist Ross Douthat woke capitalism nennt. Konzerne und Wirtschaftsverbände, die von Mindestlohn und Kündigungsschutz wenig halten, propagieren »Diversität«, eine Ideologie, in der es objektiv um die Neusortierung der Konkurrenzverhältnisse innerhalb der Mittelschicht geht. Gemeinsam ist beiden bürgerlichen Klassenfraktionen der Glaube an die Berufung des Expertentums zur Umgestaltung der Gesellschaft, gegen die als träge, ignorant und veränderungsunwillig stigmatisierte Masse. Natürlich sind hochkomplexe moderne Gesellschaften auf Expertise angewiesen. Das gilt umso mehr in Anbetracht der Herausforderungen, vor die der von der überkommenen Wirtschaftsweise hervorgerufene Klimawandel die Gesellschaft stellt. Aber ein von der Lebenswelt der unteren Klassen mittlerweile vollständig entkoppeltes Expertentum produziert sozialen Sprengstoff. Bourdieus nun fast dreißig Jahre alte Rede vom »Staats-Adel«, dessen Angehörige sich selbst für die neuen »Sachwalter göttlichen Rechts« halten, beschreibt in prophetisch anmutender Weise eine Tendenz der Refeudalisierung unserer Gesellschaft. In den Vereinigten Staaten hat Joel Kotkin eine von dystopischem Pessimismus durchwehte Analyse vorgelegt: Im Dienste einer Techno-Oligarchie übernimmt ein neuer linksliberaler »Klerus« aus Akademikern, Lehrern, Bürokraten und Beratern die Rolle der Kirche im Mittelalter, während die alte Mittelschicht die »Hintersassen« stellt und die Arbeiterschaft zu Knechten wird.12
Die mediale Dominanz der felsenfest von ihrer moralischen und volkspädagogischen Mission überzeugten neuen Mittelklasse geht einher mit einer permanenten Entwertung von Lebensmodellen, die stärker an Traditionen und lokale Kontexte gebunden oder einfach nicht mit den ökonomischen und kulturellen Ressourcen einer im Sinne der neuen Mittelklasse »korrekten« Lebensführung ausgestattet sind. Das betrifft nicht nur die alleinerziehende Mutter mit Halbtagsjob als Kassiererin, deren ökologischer Fußabdruck viel kleiner ist als der grüner Oberstudienrätinnen mit geerbtem Einfamilienhaus und Elektro-Zweitwagen, obwohl sie Salami beim Discounter kauft statt Veganprodukte aus dem Bioladen, die sie sich schlicht nicht leisten kann. Es betrifft all die Menschen, die in der Industrie, im Handwerk, im Handel arbeiten und sich nicht mehr gehört und ernst genommen fühlen. In einer tieferen Dimension betrifft es schließlich eine allgemeine Entwertung von gewöhnlicher Lebenserfahrung durch eine Akademikerkaste, die unter Berufung auf ein privilegiertes »Expertenwissen« eine Reglementierung aller Lebensbereiche vorantreibt. Wenn der traditionell SPD wählende Elektromeister, der in der Dorfgaststätte gerne ein Zigeunerschnitzel bestellt, aus dem Fernsehen erfährt, dass er »Rassist« ist, weil er das »Z-Wort« sagt, und als Fleischesser und alter weißer Mann überhaupt ein schlechter Mensch, platzt ihm natürlich irgendwann die Hutschnur. Die üblicherweise als »Kulturkampf« etikettierten Konflikte dieser Art, die Sahra gerne rhetorisch ausschlachtet, sind Oberflächenphänomene eines kombinierten, Louis Althusser würde sagen: »überdeterminierten« Widerspruchs, in dem ein ökonomischer Konflikt und ein Anerkennungskampf sich verbinden.
Erstens gilt: So wichtig die Leistungen der neuen Wissensökonomie im Hinblick auf technologische Innovation und wissenschaftliche Expertise in unser aller Existenzbedingungen betreffenden Fragen sind, so wird dennoch der Reichtum unserer Gesellschaft, der die reelle materielle Grundlage all unserer Handlungsoptionen und natürlich unseres Sozialstaats ist, nicht in den Domänen der neuen Mittelklasse produziert, nicht in unermüdlich mit der Rettung der Welt beschäftigten NGO-Büros, nicht in Instituten für Genderforschung und nicht von Fahrradkurieren mit Bachelor in Kulturanthropologie, sondern trotz aller Schrumpfungsprozesse nach wie vor wesentlich in der Industrie und ihrer Peripherie, dem mit ihr verknüpften Dienstleistungssektor.13 Karl Marx interessierte sich nicht für die Frage, wer moralisch gut, besser oder am besten ist. Er setzte nicht auf das Proletariat, weil er Industriearbeiter für die besseren Menschen hielt, sondern weil er in ihnen diejenigen erblickte, die den Reichtum der Gesellschaft produzieren und zugleich objektiv die Macht haben, die gesellschaftliche Produktion der Logik der privaten Aneignung zu entziehen und unter gesellschaftliche Kontrolle zu bringen. Die sozialistische Arbeiterbewegung ging immer davon aus, dass Menschen sich im Kampf »um den Lohngroschen, das Teewasser und die Macht im Staat« (Brecht) verändern und weiterentwickeln. Das wichtigste Kampfmittel der Arbeiter, der Streik, setzt voraus, dass alle mitmachen: Auch der Kollege, der gerne sexistische Witze macht und auf Muslime nicht so gut zu sprechen ist, muss mitgenommen werden, und ihm wird die Chance zugebilligt, im gemeinsamen Kampf etwas dazuzulernen. Die heutige Woke-Linke macht genau das Gegenteil: Sie grenzt aus, spaltet und besorgt damit die Geschäfte der Bourgeoisie. Bei allem, was sich seit den Tagen des Kommunistischen Manifests verändert hat, bleibt doch gültig, dass Veränderung im Sinne gesamtgesellschaftlicher Emanzipation nur mit denen zu machen ist, die in den »systemrelevanten« Sektoren von Produktion und Dienstleistung die Gesellschaft am Laufen halten, niemals gegen sie. Im Unterschied zu vielen, die heute das Linkssein als moralische »Haltung« definieren möchten, ist Sahra Wagenknecht von dieser Einsicht niemals abgewichen; in diesem Sinne ist sie eine gute Marxistin geblieben.
Zweitens: Im Vergleich zu der Zeit, als die großen Arbeitskämpfe in der Industrie die Messlatte für sozialen Fortschritt setzten, sind die Kampfbedingungen der Lohnarbeit heute durch eine Vielzahl von Faktoren erheblich erschwert. Während Industrie und industrienahe Sektoren in Deutschland nach wie vor wesentlich die materiellen Lebensbedingungen prägen, werden die Leitbilder der gesellschaftspolitischen Debatte vom neuen Bürgertum gesetzt: in Lebensmodellen und Verhaltenskodizes von Akademikern, denen die Erfahrungswelt von Menschen mit niedrigem Bildungsniveau und geringem Einkommen völlig fremd ist, in Konsummustern und Mobilitätskonzepten gutsituierter Großstädter, die weniger privilegierten Schichten außerhalb der besseren Wohnviertel der Metropolen nicht zu Gebote stehen, in von Campuskulturen ausgedachten Konstrukten »korrekten« Sprechens, die von der großen Mehrheit abgelehnt werden. All das geschieht, flankiert von »Experten« aller Art, vor dem Hintergrund einer Politik, die über Jahrzehnte öffentliche Güter privatisiert und Infrastrukturen kaputtgespart, soziale Mobilität blockiert und die Herausbildung einer geschlossenen Gesellschaft von Begüterten gefördert hat. Und es kulminiert in einem kopflosen »Modernisierungsprogramm«, das vorsätzlich die industriellen Grundlagen unseres Wohlstands aufs Spiel setzt und die Kosten sowohl für die notwendige Energiewende als auch für die nicht notwendige, sondern imperialen Interessen geschuldete Aufrüstung den unteren zwei Dritteln der Gesellschaft aufdrückt.
Der überdeterminierte Widerspruch, der in Deutschland wie anderswo die Gesellschaft vor eine Zerreißprobe stellt, besteht im Ineinander ökonomisch-sozialer Interessenkonflikte, die sich aus dem Modernisierungsschub der letzten Jahrzehnte ergeben, und der kulturellen Entfremdung ihrer Akteure. Wo Klassenkonflikte, die sich um die Herstellung und Aneignung materieller und immaterieller Güter drehen, sich unmittelbar als Konflikte um gegenläufige Lebensformen und Wissenspraxen artikulieren, nimmt der Klassenkampf die Form irrationaler Kulturkämpfe an. In ihnen findet der reaktionäre Rechtspopulismus seinen Resonanzboden, der in vielen Ländern das Gros der Arbeiterschaft auf seine Seite hat ziehen können. Für eine populäre, den unteren Klassen verpflichtete Linke besteht die große Schwierigkeit darin, dass sie diesen Kulturkampf nicht befeuern darf, sich in ihm aber auch nicht einfach neutral verhalten kann: Sie steht vor dem Problem, ihn rational aufzulösen, und sie kann es nicht, ohne sein Terrain zu betreten. Wer den Dreck wegräumen will, muss sich die Hände schmutzig machen.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht steht im Kern für ein Volksfrontprojekt: ein Bündnis aus Arbeiterklasse und Teilen der alten Mittelschicht gegen die Hegemonie der neuen Mittelklasse und gegen die Dominanz des Finanz- und Monopolkapitals, in das auch Kräfte des Mittelstands im produzierenden Gewerbe, Dienstleistungssektor und Handel einbezogen werden sollen. Die Arbeiterklasse als solche hat heute nicht die Voraussetzungen für die klassische Form der Mobilisierung: Sie ist zu fragmentiert, ein großer Teil ist für die überkommenen gewerkschaftlichen Organisationsformen und die durch sie vermittelte Art der Bewusstseinsbildung kaum erreichbar. Ihr Bewusstsein ist nicht mehr geprägt vom alten Klassenstolz, sondern vor allem von Erfahrungen der Degradierung, Ausschließung und Entwertung. Diese teilt sie mit großen Sektoren der alten Mittelschicht, mit der sie auch das Interesse an Erhaltung der industriellen Basis verbindet. Der wesentliche Konflikt, der heute unsere Gesellschaft in Mitleidenschaft zieht, spielt sich in ihrer Mitte ab: Es ist der Konflikt zwischen alter und neuer Mittelschicht. Der strategische Hebel von Veränderung muss hier ansetzen. Entscheidend ist aber die Frage, wer führt.
Wie tragfähig und funktionstüchtig ein solches Bündnis ist, wird sich nur experimentell über Versuch und Irrtum feststellen lassen. Unvermeidlich werden in ihm Widersprüche auftreten: Im BSW sind solche schon in der jetzigen personellen Zusammensetzung erkennbar. Noch nicht absehbar ist die künftige Entwicklung der Mitgliedschaft und ihre Auswirkung auf die Programmatik. Die Mitwirkung von Unternehmern mit sozialer Ader an diesem Klassenbündnis ist prinzipiell zu begrüßen. Nichtsdestotrotz sind bei Fragen wie dem Mindestlohn Spannungen zu erwarten, wenn dem Mittelstand die Priorität eingeräumt wird. Ein Thema, das beim BSW bislang überhaupt nicht angesprochen wurde, ist die Verkürzung der Arbeitszeit: In den 60er bis 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war sie wesentliches Ziel der Kämpfe der großen Industriegewerkschaften. Anfang dieses Jahres haben die Lokführer eine Perspektive auf die 35-Stunden-Woche erstritten. Der Mittelstand reagiert eher mit Skepsis und Bedenken. Die Verkürzung der Arbeitszeit bleibt ein Kernelement sozialer Emanzipation. In den privilegierten Angestelltensektoren nutzen die Beschäftigten ihre durch demografische Faktoren gewachsene Verhandlungsmacht für individuelle Strategien im Rahmen flexibler Arbeitszeitmodelle. Dabei darf es nicht bleiben: Die Humanisierung der »Work-Life-Balance« darf kein Privileg der Hochqualifizierten bleiben. Für das BSW wird diese Frage ein wesentlicher Prüfstein sein.
Die bislang vorliegenden demoskopischen Daten zur potenziellen Wählerschaft des BSW lassen erkennen, dass die neue Partei tatsächlich vor allem Arbeiter und Menschen mit einfachen Bildungsabschlüssen anspricht, die bislang SPD, LINKE oder AfD gewählt haben; darunter hat ein auffälliger Anteil einen Migrationshintergrund. Großenteils stehen sie in ökonomischen und sozialpolitischen Fragen eher links, während sie gesellschaftspolitisch konservativer sind als die etablierten Mitte-links-Parteien, aber liberaler als die AfD.14 In welchem Umfang das BSW die AfD schwächen kann, wird sich im Laufe der Zeit zeigen: Die in sozialen Medien häufig anzutreffenden Leute, die am liebsten eine Partei mit Sahra Wagenknecht und Alice Weidel hätten, werden merken, dass Sahra ihnen diesen Gefallen auf keinen Fall tun wird, und im Zweifelsfalle Weidel wählen. Im Gegenzug sollte sich auch im BSW die Einsicht durchsetzen, dass das Kleinbürgertum mit gefestigtem rechten Weltbild keine Gewinn bringende Zielgruppe ist und Konzessionen an ihre asoziale Ideologie nichts nützen, sondern der eigenen Substanz schaden. Im günstigsten Falle könnte das BSW zur politischen Vertretung der Arbeiterschaft werden, die von Sozialdemokratie und Linkspartei im Stich gelassen wurde. Ob das gelingt, ist allerdings nicht ausgemacht.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht spricht nicht vom Klassenkampf. Die Parole der »Vernunft und Gerechtigkeit« zielt strategisch darauf, der elitären neuen Mittelklasse das von ihr anmaßend beanspruchte Monopol auf Vernünftigkeit zu entreißen. Damit ist das BSW objektiv eine Partei des Klassenkampfs.
Linkskonservativ: ein legitimes Konzept
Die »Linke«, mit der wir Älteren noch aufgewachsen sind, war eine politische Formation, die sich im ausgehenden 19. Jahrhundert herausbildete durch das Bündnis aus sozialistischer Arbeiterbewegung und dem bürgerlichen Linksliberalismus: Beide Gruppierungen hatten zuvor nicht sehr viel gemein, aber das beiderseitige Interesse an der Abwehr reaktionärer Bestrebungen – in Deutschland Bismarcks »konservative Wende« um 1880, in Frankreich die Dreyfus-Affäre – führte zum Schulterschluss. In der alten Bundesrepublik vor 1990, wo die herrschende Klasse markante politische Charakterdarsteller vom Schlage eines Franz Josef Strauß hatte, gab es eine antikapitalistische Linke, die eine Veränderung der Eigentumsverhältnisse und der gesellschaftlichen Produktionsweise anstrebte, und es gab Linksliberale oder Sozialliberale, die so weit nicht gehen wollten, sich mit der sozialstaatlichen Zähmung des Kapitalismus begnügten und dem linken Kollektivismus – nicht immer ganz zu Unrecht – misstrauten, aber doch wichtige Verbündete im Kampf für Demokratisierung und Gleichberechtigung, für den Abbau von Privilegien waren. Aus der industriellen Arbeiterbewegung bezog die Linke ihr Modell kooperativer sozialer Vernunft.
Die Niederlage des Sozialismus und die Schwächung der Arbeiterbewegung nach 1990 hat das politische Koordinatensystem tiefgreifend verändert. Große Teile der sozialdemokratischen und grünen Linken gaben die Perspektive einer Überwindung der kapitalistischen Eigentumsordnung auf und verlegten ihr »Linkssein« auf ein gesellschaftspolitisches und kulturelles Terrain. An die Stelle des Kampfes für vertikale Gleichheit trat ein Plädoyer für horizontale Gleichheit: Das Paradigma »Ausbeutung« wurde als Schlüsselkategorie der Analyse und Kritik von Herrschaftsverhältnissen durch das Paradigma »Diskriminierung« und der Kampf gegen die herrschende Klasse durch den Kampf gegen die »Dominanzkultur« der Mehrheitsgesellschaft ersetzt, an die Stelle der Opposition gegen materielle Hierarchien trat die Forderung nach gleichberechtigter Repräsentation von Minderheiten auf allen Ebenen der sozialen Hierarchie. Das Ergebnis sind »linke« Diskurse, in denen die schwarze Schulamtsdirektorin als Diskriminierungsopfer und der weiße Lagerarbeiter, der mit seinem kaputten Rücken in Frührente gehen muss, als »privilegierter« Vertreter der »Dominanzgesellschaft« erscheint. Das Kategoriensystem der Linken hat sich in Richtung Linksliberalismus verschoben.
Auch die Teile der Linken, die an antikapitalistischen Zielsetzungen festhalten, sind in den Sog dieses Linksliberalismus geraten. In den vorangehenden hundert Jahren war man gewohnt, zusammen mit den Linksliberalen für die Sache des »Fortschritts« einzutreten. Während man unter Fortschritt vormals die Teilhabe der breiten Masse am gesellschaftlichen Reichtum und die Unterwerfung des Produktionsprozesses unter die kollektive Kontrolle der Produzenten verstand, gilt als solcher heute die »Selbstbestimmung« eines abstrakten, traditions-, bindungs- und eigenschaftslosen Individuums. Dass diese Abstraktion selbst nichts anderes ist als eine Fetischgestalt bürgerlicher Vergesellschaftung, wird nicht mehr verstanden. Kapitalismuskritische Linksliberale kritisieren den wirtschaftlichen Marktliberalismus, propagieren soziale Rechte und gleichzeitig einen schrankenlosen individualistischen Gesellschaftsliberalismus mit Zielsetzungen von der Freigabe von Drogen bis zu »offenen Grenzen«. Welche Inkonsistenz in diesem Konzept liegt, hat vor fast zwanzig Jahren der links-kommunitaristische Philosoph Jean-Claude Michéa gezeigt, dessen brillanter Essay über den Liberalismus als »Reich des kleineren Übels« in Frankreich Furore machte, in Deutschland aber kaum Beachtung fand: Die Trennung von »schlechtem« Wirtschaftsliberalismus und »gutem« Gesellschaftsliberalismus ist nicht durchführbar, weil es sich um zwei Seiten einer Medaille handelt – nämlich eines Vergesellschaftungsmodus, in dem der Zusammenhalt des Ganzen nur über die »technischen«, ethisch und weltanschaulich neutralen Instanzen Markt und Recht gestiftet wird.
Mit dem Aufstieg der neuen Mittelschicht auf die Kommandobrücken der Gesellschaft ist die vormals konservative herrschende Klasse selbst in weiten Teilen liberal geworden. Ihr Linksliberalismus ist für eine klassenorientierte Linke kein Verbündeter mehr, und ihre Idee von »Fortschritt« erweist sich als regressiv. Daraus ergibt sich die Frage nach anderen Allianzen. Sahra hat in ihrem letzten Buch »Die Selbstgerechten« das Stichwort »linkskonservativ« aufgeworfen. Auch wenn ihre Argumente nicht in allen Punkten überzeugen und ihre Perspektive blass, vage und in manchen Aspekten zweifelhaft bleibt, stellt sie berechtigte Fragen zur Debatte.
Die Idee einer »linkskonservativen« Orientierung stößt in weiten Teilen der Linken als vermeintliches Oxymoron auf reflexhafte Ablehnung, weil »links« mit Fortschritt und »konservativ« mit Rückwärtsgewandtheit verbunden wird. Konservatismus steht pauschal in den Ruf, immer und ausschließlich Herrschaftsinteressen zu dienen. Eine derart schematische Sichtweise verkennt die reale historische Komplexität sozialer Triebkräfte. Eine historische und systematische Erörterung, die weit ausholen müsste, kann an dieser Stelle nicht stattfinden und muss späteren Einlassungen vorbehalten bleiben. Ich beschränke mich auf summarische Hinweise: Eine »linkskonservative« Position – die nicht als Doktrin zu verstehen wäre, sondern als Korrektiv in einer bestimmten historischen Konjunktur – wäre nur dann unmöglich oder absurd, wenn der starke Universalismus, der die conditio sine qua non jeder linken Position ist, und der für konservatives Denken konstitutive Respekt vor Geschichte, vor dem Gewicht des historisch Gewachsenen einander kategorial ausschlössen. Das ist aber nicht der Fall.
In England, wo Anfang des 19. Jahrhunderts die Industrialisierung am weitesten fortgeschritten war, fanden die Arbeiter in ihren ersten Ansätzen organisierter Gegenwehr gegen die Unterwerfung des Menschen unter Marktgesetze mehr Verbündete unter Christlich-Konservativen als unter den Liberalen und Progressiven – diese haben die ohnehin schikanösen Armengesetze aus der elisabethanischen Ära nicht etwa gemildert, sondern verschärft. Es lohnt sich, über die Gründe nachzudenken, aus denen Karl Marx für »progressive« Sozialreformer wie den damals tonangebenden Jeremy Bentham nur Hohn und Spott übrig hatte, dem konservativen Radikalen William Cobbett, der aus seinem naturrechtlichen Radikalismus heraus zum vehementesten Fürsprecher der Arbeiter wurde, hingegen hohen Respekt zollte.15 Marx und Engels erkannten freilich, dass ein moralisch motivierter Widerstand gegen die kapitalistische Modernisierung chancenlos war. Ihre Idee eines »wissenschaftlichen Sozialismus« suchte die Perspektive sozialer Emanzipation aus der Dynamik des historischen Fortschritts herzuleiten, blieb dabei aber doch in vieler Hinsicht rückgebunden an ein historisches Erbe, dem der Impuls ihrer Radikalität entsprang.16 Ohne »romantischen« Antikapitalismus hätte es keinen Sozialismus gegeben. Es ist kein Zufall, dass eine marxistisch informierte Arbeiterbewegung in Europa wirkmächtig war, nicht jedoch in Nordamerika mit seiner rein bürgerlichen Gesellschaft ohne feudale Erbmasse.
Im Jahr 1973 schrieb der bekannte sozialdemokratische Politologe und Marx-Erklärer Iring Fetscher einen bemerkenswerten Essay »Konservative Reflexionen eines Nicht-Konservativen«.17 Der Kern seiner Argumentation besteht in dem Gedanken: Menschen haben einerseits ein Recht auf Veränderung – das »Recht, ein anderer zu werden«, von dem die linke Theologin Dorothee Sölle sprach. Komplementär dazu haben Menschen aber auch ein »Recht, man selbst zu bleiben«. In diesem Zusammenhang verweist Fetscher auf die damals in Norwegen geführte Debatte um einen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, über den ein Referendum ablehnend entschied. In dieser Debatte ging es etwa um Fischer, die es vorzogen, ihre traditionelle Lebens- und Arbeitsweise in kleinen Familienbetrieben zu verteidigen, statt ihre Zukunft in der Lohnarbeit für Konzernflotten zu sehen, mit der sie vielleicht mehr verdient, aber ihre Autonomie eingebüßt hätten. Diese »rückständigen« norwegischen Fischer fanden auch Unterstützung aus der Linken.
Heute sehen offensichtlich viele Menschen ihr »Recht, man selbst zu bleiben«, bedroht. Sie empfinden den über sie verhängten »Fortschritt« als Kontrollverlust. Zu ihrem Anwalt macht sich die reaktionäre Rechte. Demgegenüber führt Fetscher aus, dass weder das »Recht, ein anderer zu werden« noch das »Recht, man selbst zu bleiben« absolute Geltung beanspruchen können. Vielmehr sollten sie Gegenstand der Abwägung in freier und pluraler demokratischer Debatte sein. In diesem Sinne hätte eine angemessene »linkskonservative« Konzeption eine linke Position in Wirtschafts- und Sozialpolitik mit einer moderat konservativen Gesellschaftspolitik zu verbinden – mit einem sehr starken Akzent auf »moderat«. Sie hätte konservative Interessen gerade der unteren Bevölkerungsschichten zu respektieren, ohne sie absolut zu setzen. Sie hätte darauf hinzuarbeiten, kulturelle Polarisierungen zu entschärfen und den rationellen Kern der Auseinandersetzung in fairer Weise freizulegen.
»Linkskonservativ« ist in diesem Sinne ein legitimes, gut begründetes und vor allem: pluralistisches Konzept. Es hat immer verschiedene Konservatismen gegeben. So muss auch eine linkskonservative Plattform für verschiedene Interpretationen offen sein. »Konservativ« heißt dem Wortsinn nach »bewahrend«: Man kann natürlich darüber streiten, was bewahrenswert ist oder nicht. Noch in den 1980er Jahren haben wir Altlinken allzu oft den Fehler begangen, die Begriffe »konservativ« und »reaktionär« synonym zu gebrauchen. Wir glaubten an die objektive Gesetzmäßigkeit des Fortschritts und taten alle Zweifel daran pauschal als ignorant und borniert ab. Aber »konservativ« und »reaktionär« ist nicht dasselbe. Während reaktionäres Denken ein vermeintlich besseres Gestern restituieren will, bedeutet Konservatismus nicht die Ablehnung von Veränderung und Fortschritt, sondern Differenzierung: In der Gestaltung geschichtlicher Prozesse ist auch das mitzubedenken, was am historisch Überlieferten valide Quelle von Sinn und Glück bleibt. In diesem Sinne hat Konservatismus etwas mit Selbstbestimmung zu tun: als Einspruch gegen die »Alternativlosigkeit« von Umwälzungen. Ein solcher Konservatismus wäre einer, der für ein Mehr an Möglichkeiten steht statt für ihre Beschneidung.
Über Veränderung
Das Bündnis Sahra Wagenknecht, so war neulich in der taz zu lesen, sei eine Partei für die »Veränderungsmüden« mit ihrer »Sehnsucht nach gestern«.18 Das ist die typische Arroganz, mit der die neue Mittelklasse auf diejenigen hinabblickt, deren »Recht, man selbst zu bleiben« in der linksliberalen Fortschrittserzählung keinen Platz hat. Die Frage ist, wer wirklich veränderungsmüde ist.
Der Journalist Frank Sieren, dem wir eine facettenreiche Berichterstattung aus China verdanken, hat am treffendsten beschrieben, welche »Zeitenwende« wir tatsächlich erleben. So wie im 19. Jahrhundert in Europa ein Zeitalter unaufhaltsam zu Ende ging, wo eine kleine von Geburt privilegierte Minderheit über die Mehrheit herrschte, so endet im 21. Jahrhundert die Epoche, in der 15 Prozent weiße Europäer und Nordamerikaner den Lauf der Welt bestimmen. Asien, Afrika, Lateinamerika fangen an, mitzureden. Sie lassen sich nicht mehr die Weltsicht des Westens aufzwingen. (Exemplarisch dafür stand kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine die Außenministerin der Republik Südafrika, die in einem Interview den Suggestivfragen eines ZDF-Journalisten souverän konterte.) Im 19. Jahrhundert haben Anhänger des feudalen ancien régime versucht, den Prozess der demokratischen Revolution aufzuhalten. Aber es gab unter den Adligen auch Einsichtige, die verstanden, dass der Wandel unaufhaltsam ist, und sich darum bemühten, ihn mitzugestalten. Manche wurden sogar selbst zu Revolutionären.
In unserem Jahrhundert versuchen Vertreter unserer alten und neuen Bourgeoisie, den Aufstieg des globalen Südens aufzuhalten. Sie werden keinen Erfolg haben. Chinesen und Inder, Südafrikaner und Brasilianer pfeifen auf die moralgeschwängerten Belehrungen der deutschen Außenministerin.
An uns wäre es, Veränderungen zu gestalten: von einem hegemonialen zu einem kooperativen Europa. Dieser Prozess wird mit vielen Widersprüchen einhergehen. Auch diesen Widersprüchen wird eine linkspopuläre Partei sich stellen müssen. Auch und gerade das Verhältnis zum Süden wird einer der Prüfsteine sein, an dem sich ihr Unterschied zu den rechten Herrenmenschenvereinen erweisen muss. Es bleibt zu hoffen, dass das BSW hier Stärke beweisen kann.
Alles in allem hat das Bündnis Sahra Wagenknecht eine Chance verdient. Wenn es die Herausforderungen der Gegenwart mit »sieben zu drei« besteht, wäre viel gewonnen. Wer nichts wagt, gewinnt nicht.
-
Hegel, Werke, Red. Moldenhauer/Michel, Bd. 12, Frankfurt 1970, S. 46. ↩︎
-
Eine Kleinpartei namens »Partei der Vernunft« gibt es ja in Deutschland schon: Ihr Programm ist libertär-marktradikal. ↩︎
-
Hegel, a.a.O., S. 49. ↩︎
-
Man erinnere sich in diesem Zusammenhang der gefälschten Webseite, die im Herbst vorigen Jahres nach der Gründung des BSW-Vereins auftauchte: Der Fälscher bediente sich einer eindeutig rechten Phraseologie (»unser Volk«), die Sahra sich niemals unterkommen lassen würde. Ihr geht es darum, mit mehrdeutigen und variabel interpretierbaren Äußerungen Wähler anzusprechen, die so denken oder zumindest empfänglich für solche Parolen sind, um deren Protest in eine andere Richtung zu kanalisieren. In sozialen Medien wurde die Fälschung von manchen AfD-Anhängern ernst genommen, die glaubten, die Wagenknecht habe ihre Positionen übernommen. ↩︎
-
Noch abrufbar unter https://populaere-linke.de. ↩︎
-
»Eine Gleichung mit Unbekannten«, taz vom 1. Juni 2024. ↩︎
-
Sogar der renommierte elder statesman Klaus von Dohnanyi, der in der SPD immer am rechten Rand stand, hat sich anerkennend über Sahra geäußert. Mit seinen 95 Jahren ist er jedoch als Mitstreiter zu alt. ↩︎
-
Der Ausdruck »Lifestyle-Linke« stammt übrigens nicht von Sahra: Er taucht zuerst 1999 im Titel eines Buches des leider zu früh verstorbenen Robert Kurz auf – der bei allem, was man gegen ihn einwenden kann, doch ein nicht korrumpierbarer Intellektueller von Format war. Seine pointierte Kritik der postmodernen »Plastikdiskurse« hat schon damals den Nagel auf den Kopf getroffen. ↩︎
-
Der sächsische Landesvorsitzende Jörg Scheibe, Ingenieur und Unternehmer, teilte in einem Interview (taz vom 20. Mai 2024) mit, lange Zeit aus ökologischen Gründen die Grünen gewählt zu haben, mit denen er wegen ihres Bellizismus brach. Der Schatzmeister Ralph Suikat setzt als Investor gezielt auf ökologische Unternehmen mit Bereichen wie Elektromobilität und vegane Ernährung. ↩︎
-
Reckwitz hat in London bei Anthony Giddens studiert, der einen marxistischen Hintergrund hatte, nach 1990 jedoch zum Vordenker des »Dritten Wegs« von New Labour wurde. ↩︎
-
Discours de Pierre Bourdieu aux cheminots grévistes, https://13.site.attac.org/spip.php?article1680. ↩︎
-
Joel Kotkin: The Coming of Neo-Feudalism, New York 2020. Ders.: The Two Middle Classes, https://quillette.com/2020/02/27/the-two-middle-classes. ↩︎
-
Vgl. O. Emons, H. Steinhaus, St. Kraft: Mitbestimmungsreport Nr. 73, 04.2022 des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung. ↩︎
-
H. Emmler, D. Seikel: Wer wählt »Bündnis Sahra Wagenknecht«? WSI Report Nr. 94, Juni 2024. ↩︎
-
Bentham erweist sich im Hinblick auf den heutigen Linksliberalismus als ausgesprochen paradigmatischer Denker nicht nur darin, dass bei ihm Liberalismus und Überwachungsstaat einander kompatibel sind. Er verabscheute die christliche Moral, trat für Frauenemanzipation, die Entkriminalisierung von Homosexualität sowie Tierrechte ein und verachtete die Armen. ↩︎
-
In welcher Hinsicht Marx dem konservativen Denken methodologisch näher stand als dem Liberalismus, untersuchte Andrew Collier: Marx and Conservatism, in: A. Chitty, M. McIvor (Hrsg.): Karl Marx and Contemporary Philosophy, Basingstoke/New York 2009, S. 99–104. ↩︎
-
In: Merkur, Heft 305, Oktober 1973. Volltext unter https://www.merkur-zeitschrift.de/iring-fetscher-konservative-reflexionen-eines-nicht-konservativen. ↩︎
-
Stefan Reinecke: »Eine Partei für Veränderungsmüde«, taz vom 19. Mai 2024. ↩︎