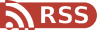Stunde der Wahrheit
Die Europawahl hat neue Tatsachen geschaffen und eine Monate anhaltende Spannung aufgelöst: Das Parteiensystem in Deutschland hat sich verändert.
- Bloß ein halbes Jahr nach seiner Gründung als Kaderpartei mit wenigen hundert handverlesenen Mitgliedern hat das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) aus dem Stand 6 Prozent erreicht. Im Osten ist es mehr als doppelt so stark wie im Westen.
- Die LINKE, vor knapp zwanzig Jahren aus der Fusion von PDS und WASG hervorgegangen, ist auf unter 3 Prozent abgestürzt.
- Die AfD ist mit 16 Prozent bundesweit zweitstärkste Partei, in allen Ost-Ländern sogar die stärkste.
Das BSW hat Chancen, sich in den nächsten Jahren in Bund und Ländern als gewichtiger politischer Faktor zu etablieren. Eine Partei, die wirtschafts- und sozialpolitisch linke Positionen mit einer gesellschaftspolitisch eher konservativen Haltung (Kritik an unkontrollierter Einwanderung, Ökoaktivismus, Gendersprache usw.) verbindet und damit das gewohnte Links-rechts-Schema unterläuft, ist in Deutschland ein Novum: Der links-konservative Quadrant des politischen Koordinatensystems war bislang unbesetzt, während im links-liberalen Segment drei Parteien (SPD, Grüne, LINKE) konkurrieren, im rechts-konservativen zwei (CDU/CSU, AfD, darüber hinaus regional auch die Freien Wähler), und auf dem rechts-liberalen Feld die FDP sich zäh behauptet. Das respektable Wahlergebnis des BSW zeigt, dass für links-konservative Politik eine reelle gesellschaftliche Nachfrage besteht. Allerdings beruht der Erfolg der neuen Partei zunächst einzig auf dem Charisma der Gründerin und Namensgeberin: Ohne das nonkonformistische Individuum Sahra Wagenknecht, das diese bislang tabuisierte Repräsentationslücke erschlossen hat, wäre eine solche Formation niemals entstanden. Ob sie auch jenseits des »Personenkults« dauerhaft in der Gesellschaft Fuß fassen kann, bleibt abzuwarten.
Für die LINKE schlug die Stunde der Wahrheit. Über Jahre war Sahra Wagenknecht ihre mit Abstand populärste Repräsentantin, mit ihrem gesellschaftspolitischen Konservatismus und »populistischen« Politikstil allerdings den im Parteiapparat dominierenden Milieus aus bewegungslinken Aktivisten und linksliberalen Realpolitikern verhasst. Immer wieder war zu hören, Sahra schädige die Partei, indem sie die progressive Klientel mit »rechten« Positionen verprelle. Zunehmend schlechte Wahlergebnisse, zuletzt das Ausscheiden aus dem hessischen Landtag, wurden ihr angelastet. Sogar ihr Ausschluss wurde gefordert. Nachdem Sahra dann aus eigenem Entschluss gegangen war, freute man sich über eine Welle von Neueintritten. Die Nominierung der parteilosen Carola Rackete fürs EU-Parlament setzte ein Signal: Man will die Avantgardepartei der »progressiven« Aktivistenmilieus sein, denen die Grünen zu angepasst und kompromisslerisch sind. Das Ergebnis ist der Absturz ins Bodenlose.
Es ist unwahrscheinlich, dass die LINKE sich von diesem Debakel erholen wird. Zwar ist der »bewegungslinke« Kurs der Führung um Martin Schirdewan und Janine Wissler innerparteilich keineswegs unumstritten. Nach wie vor existiert ein bodenständigerer Flügel, der auf eine sozialpolitische Profilierung mit »Brot-und-Butter-Themen« für die unteren Einkommensschichten drängt. Und immer wird beteuert, dass man das Eintreten für Interessen der breiten Mehrheit in den Bereichen Arbeit, Rente, Wohnen, Gesundheit und die Solidarität mit Flüchtlingen, den Öko-, Minderheiten- und Genderaktivismus nicht gegeneinander ausspielen, sondern miteinander verbinden müsse. Das Problem ist: Menschen mit niedrigem sozioökonomischen Status denken nicht so. »Intersektionalität« ist ein Slogan von Akademikern. Wer von Haupt- und Nebenwidersprüchen nichts wissen will und meint, Mehrheits- und Minderheitenthemen, Rentenversicherung und Transgender-Toiletten seien politisch gleich wichtig, erreicht nur Minderheiten. Mit unter drei Prozent darf die LINKE in Zukunft mit anderen progressiven und linksliberalen Kleinparteien wie Volt oder der Tierschutzpartei konkurrieren.
Das Erbe der Linkspartei als soziale Opposition könnte dem BSW zufallen. Eine wenige Tage vor der Europawahl veröffentlichte Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung1 ist zu dem Befund gelangt, dass das BSW tatsächlich in hohem Maße für Arbeiter und Menschen mit einfachen bis mittleren Bildungsabschlüssen und geringem Einkommen attraktiv ist. Sahras Grundidee besteht allerdings darin, die Interessen dieser Zielgruppe in einer Art Einheitsfront mit denen der von Abstiegsängsten geplagten alten Mittelschicht gegen die Hegemonie der urban-akademischen »neuen Mittelklasse« (Andreas Reckwitz) zu verbinden. Gemeinsam ist beiden Gruppen die Erfahrung der Entwertung ihrer Lebensweisen durch die medial dominante grün-linksliberal-kosmopolitische Modernisierungsavantgarde und ein Interesse an der Erhaltung der industriellen Substanz, die in Deutschland nach wie vor die wesentliche Grundlage des Wohlstands bildet. Sahra hat verstanden, dass man die Arbeiter heute nicht mehr durch Anrufung ihres Klassenstolzes erreicht, den sie nicht mehr haben, sondern sie »populistisch« als Teil der Mitte der Gesellschaft ansprechen muss. Ein solches Einheitsfrontprojekt ist sinnvoll, es wird aber viele innere Widersprüche bewältigen müssen.
Vor allem trat Sahra auch mit dem Versprechen an, mit einer »vernünftigen«, seriösen »Alternative zur Alternative« den Aufstieg der AfD zu stoppen. Immer wieder hat sie argumentiert, die meisten Wähler der AfD seien keine Rechtsextremisten, sondern verunsicherte und von den etablierten Parteien enttäuschte Protestwähler. Auch unter ihren linksliberalen oder konservativen Kritikern und Verächtern haben manche ihr als einzigen Pluspunkt zugute gehalten, dass sie die AfD dezimieren könnte.
An die Stelle solcher Spekulationen sind jetzt Fakten getreten: Die AfD bleibt zwar hinter den Werten zurück, die sie Anfang des Jahres in Umfragen erreichte, als sie ein Potenzial von bundesweit mehr als 20 Prozent hatte. Dass sie dieses Potenzial aus dem temporären Umfragehoch nicht ausschöpfen konnte, war absehbar. Das hat zweifellos multiple Gründe. Mit »nur« 16 Prozent ist die AfD dennoch bedeutend stärker als bei der letzten Bundestagswahl, sie ist vor SPD und Grünen die zweitstärkste Kraft und im Osten überall die stärkste.
Die Studie der Böckler-Stiftung hat gezeigt, dass das BSW für potenzielle AfD-Wähler vor allem im Osten, also für solche, die in der Zeit des Umfragehochs um die Jahreswende mit der AfD sympathisierten, eine willkommene Alternative ist. Die Wählerwanderungsanalysen, deren Referenz das reelle Verhalten bei vorangegangenen Wahlen ist, kommen allerdings zu dem Ergebnis, dass der Erfolg des BSW hauptsächlich auf dem Zulauf ehemaliger Wähler von SPD und Linkspartei beruht, in geringerem Maße auch von den Unionsparteien, und ganz besonders aus dem Lager vormaliger Nichtwähler. Der Zufluss von der AfD spielt keine bedeutende Rolle.
Das hätte man ahnen können. Die Forschung bestätigt, was man längst weiß, wenn man in den sozialen Netzwerken, wo die AfD überaus aktiv ist, die Szenerie beobachtet: Die AfD stützt sich inzwischen auf ein sehr geschlossenes und verhärtetes Milieu. Ein Bedarf an einer »Alternative zur Alternative« besteht dort nicht. Zwar genießt Sahra Wagenknecht unter AfD-Anhängern durchaus Sympathien – AfD-Politiker von Gauland bis Höcke haben ihr Respekt gezollt und sie gar zum Übertritt eingeladen. Und man trifft immer wieder auf Leute, die am liebsten eine neue Partei mit Sahra Wagenknecht und Alice Weidel hätten. Da Sahra ihnen einen solchen Gefallen allein schon wegen der Inkompatibilität der wirtschaftspolitischen Grundpositionen niemals tun wird, bleiben sie bei Weidel. Auch wenn Sahra selbst in AfD-Kreisen in gutem Ruf steht, gilt das keineswegs für die linken Kader, auf die sie sich stützt. Fabio De Masi, Andrej Hunko oder Klaus Ernst werden dem Wagenknecht-Weidel-Wutbürgertum suspekt sein, und in Sevim Dağdelen, Żaklin Nastić oder Ali Al-Dailami dürfte der Höcke-Volkssturm eher Kandidaten für »Remigration« denn politische Verbündete sehen.
Offensichtlich hat das BSW manche Wähler gewinnen können, die um die Jahreswende noch aus Frustration in Richtung AfD tendierten. Aber nur wenige haben tatsächlich schon einmal AfD gewählt. Nach den vorliegenden Erkenntnissen handelt es sich um Menschen beiderlei Geschlechts und jeden Alters, nicht selten auch mit Migrationshintergrund, die wirtschafts- und sozialpolitisch nach links tendieren und gesellschaftspolitisch konservativer sind als der linksliberale Mainstream, aber liberaler als die AfD. Für diese Gruppe ist ein links-konservatives Angebot interessant. Aber an den harten Kern der AfD-Klientel kommt das BSW nicht heran.
Es bleibt zu hoffen, dass das BSW daraus die richtigen Lehren zieht: Der Versuch, mit rechtsoffener Rhetorik am rechten Rand Stimmen einzufangen, ist zwecklos und ineffizient. Die Aufgabe des BSW besteht darin, mit linken, aber an die Mitte der Gesellschaft anschlussfähigen Positionen die Interessen von Arbeitern und der unteren Mittelschicht zu vertreten, »Schutzmacht der kleinen Leute« zu sein, die SPD und LINKE nicht mehr sind. Dazu gehört eine Gesellschaftspolitik, die moderat konservativ mit einem sehr starken Akzent auf »moderat« zu sein hätte: dialogbereit, nicht ausgrenzend, Lebenserfahrungen achtend, nicht verhärtend. Die spannende Frage ist, ob in den nächsten Jahren ein gleitender Übergang vom Sprachrohr einer charismatischen Volkstribunin zu einer vielstimmigen, gesellschaftlich breit verankerten Kraft gelingt – die zu guter Letzt auch progressive Gebildete davon überzeugen könnte, dass es intelligentere Perspektiven einer solidarischen Gesellschaft und lebenswerten Zukunft gibt als das Mitschwimmen im Strom der »Lifestyle-Linken«.
-
H. Emmler, D. Seikel: Wer wählt »Bündnis Sahra Wagenknecht«? WSI Report Nr. 94, Juni 2024. ↩︎