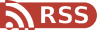It’s all Greek to me
Vor fünfzig Jahren, im Juli 1974, stürzte in Griechenland die Militärdiktatur: Der Versuch einer Rückeroberung Zyperns ging den westlichen Verbündeten zu weit. General Papadopoulos war bereits Ende 1973 zurückgetreten. Das Regime seines Nachfolgers Ioannidis brach zusammen, als der auf Zypern inszenierte Putsch durch eine Invasion der Türkei niedergeschlagen wurde. Einen das Alltagsleben aller Griechen berührenden, von der überwiegenden Mehrheit als ungeheuer befreiend empfundenen Einschnitt markierte das Ende der »Junta« auf dem Gebiet der Sprache: Endlich durften die Griechen überall in der Öffentlichkeit ihre Muttersprache sprechen, statt sich mit einem von Akademikern ausgedachten Artefakt abquälen zu müssen. Der Fall des Obristenregimes ebnete den Weg zur Lösung der »griechischen Sprachfrage«.
Im Englischen meint die auf Shakespeare zurückgehende Redewendung »It’s all Greek to me«, dass etwas unverständlich ist. Die Griechen allerdings haben Zeiten erlebt, in denen in ihrem eigenen Land die Obrigkeit ein Griechisch sprach, das die Mehrheit kaum verstand. Vor allem General Georgios Papadopoulos, der mit einem Militärputsch am 21. April 1967 die Macht übernahm, legte besonderen Wert darauf, zwecks Simulation nationaler Größe seine reaktionären Botschaften in einem für Nichtstudierte altertümlich, elitär und kryptisch anmutenden Sprachduktus zu verlautbaren.
Οἱ Ἕλληνες καὶ κατὰ ἱστορικὴν παράδοσιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν βασικὴν ἀντίληψιν καὶ ἀγωγὴν δὲν εἶναι ποτὲ εὐεπίφοροι πρὸς τὸν κομμουνισμόν, διότι ὁ κομμουνισμὸς δὲν δύναται νὰ ἔχει οὐδὲν σημεῖον κοινὸν μὲ τὸν ἑλληνοχριστιανισμὸν ποὺ ἀποτελεῖ τὴν βάσιν τῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὸν δρόμον τῆς ἱστορίας των …1
»Die Griechen sind gemäß ihrer historischen Tradition, aber auch gemäß ihrer grundlegenden Wahrnehmung und Bildung niemals empfänglich für den Kommunismus, weil der Kommunismus nichts mit dem griechischen Christentum gemein haben kann, das die Basis der Erziehung der Griechen entlang dem Weg ihrer Geschichte ist …«
Die zum Inhalt passende sprachliche Form fand die Weltsicht des Diktators in der »Katharevousa«: sozusagen ein auf alt getrimmtes Neugriechisch aus dem 19. Jahrhundert. Als Griechenland nach Jahrhunderten türkischer Fremdherrschaft unabhängig wurde, träumte seine Elite davon, die erhoffte Wiederkehr zu antikem Glanz auch sprachlich zu vollziehen und dem Volk seine »verdorbene« Umgangssprache auszutreiben. Auch Papadopoulos hat das noch einmal versucht und sich zum Gespött gemacht, weil er die altertümelnde »Hochsprache«, die in Politik, Verwaltung, Wissenschaft und Wirtschaft obligatorisch war, selbst nur mangelhaft beherrschte.
Während Byzanz ein für mittelalterliche Verhältnisse hohes Bildungsniveau hatte, waren die meisten Griechen im Osmanischen Reich Analphabeten. Daran waren nicht die Türken schuld, die den unterworfenen christlichen Völkern sehr weitgehende Autonomierechte einräumten, sondern die griechische Kirche, die kein gebildetes Volk wollte. Als gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Unabhängigkeitsbewegung Fahrt aufnahm, diskutierten die Intellektuellen über die Amtssprache eines künftigen griechischen Staates: Die Volkssprache erschien ungeeignet, weil verwildert, degeneriert und durch die vielen Lehnwörter überfremdet, die aus dem Türkischen und durch Handelskontakte auch aus dem Italienischen und Französischen eingesickert waren – aus der Sicht der Gebildeten war sie ein von Ausländern verdorbener Bauerndialekt. Eine Rückkehr zum Altgriechischen, das nur der kleinen, überwiegend dem Klerus angehörenden Bildungselite vertraut war, erschien allerdings praktisch undurchführbar: Altgriechisch zu sprechen ist in Anbetracht seiner enorm hohen grammatikalischen Komplexität äußerst schwierig. Hätte jeder Postbeamte am Schalter die Kundschaft auf Altgriechisch bedienen müssen, so wäre das Scheitern vorprogrammiert gewesen – es wäre so, wie wenn man von Italienern verlangen wollte, Latein zu sprechen. Als Kompromiss erfand man zur »Reinigung« des Neugriechischen die »Katharevousa«: Fremd- und Lehnwörter wurden getilgt und durch altgriechische Ausdrücke ersetzt, in der Grammatik wurde eine überschaubare Untermenge der altgriechischen Formen nebst einiger mittelgriechischer Versatzstücke wiederhergestellt.
Dieses Hybridkonstrukt wurde im griechischen Königreich (dessen erster Monarch ein vom Altgriechischen begeisterter Bayer aus dem Hause Wittelsbach war) zur offiziellen Sprache. Die große Mehrheit ohne höhere Schulbildung verstand sie schlecht und konnte sie nicht sprechen. Korrespondenzen mit Behörden mussten in Katharevousa geführt werden – Bauern, Fischer oder Handwerker mussten dafür die Dienste bezahlter Schreiber in Anspruch nehmen. Immerhin nahmen die meisten Schriftsteller ab 1880 Abstand von der Katharevousa, die ihnen zu gekünstelt erschien, und gingen zur »Dimotiki«, zur Volkssprache über. Es war allzu lebensfremd, Literatur in einem Idiom abzufassen, das zu Hause wahrscheinlich nicht einmal die Bildungsbürger sprachen.
Der Streit über die Sprache war permanenter Bestandteil politischer Auseinandersetzungen: Linke, liberale und progressive Kräfte traten für die Volkssprache ein, während das konservative, nationalistische und klerikale Lager auf der Katharevousa bestand. Als 1901 ein Athener Zeitungsverlag eine Übersetzung des Matthäusevangeliums in volkssprachliches Neugriechisch druckte, kam es zu gewaltsamen Ausschreitungen. Im 20. Jahrhundert gewann die Dimotiki allmählich an Boden. General Papadopoulos schließlich unternahm den letzten Versuch, die Volkssprache zurückzudrängen. Kinder lernten in der Schule, dass das, was im Elternhaus gesprochen wurde, kein wahres Griechisch sei, Katharevousa musste gepaukt werden. Das Volk hat aber die Katharevousa niemals angenommen. Mit dem Sturz des Obristenregimes fand ein hundertfünfzig Jahre andauernder Versuch der sprachlichen Umerziehung eines Volkes durch Bildungseliten sein Ende. 1976 wurde die Katharevousa als Amtssprache offiziell abgeschafft. An ihre Stelle trat die auf der Dimotiki beruhende neugriechische Standardsprache κοινή νεοελληνική.
Eine lange Geschichte der Diglossie
Diglossie, das Nebeneinander zweier Sprachen von unterschiedlicher sozialer Wertigkeit, kennen etwa die Schweizer, die im Alltag Schweizerdeutsch und in formellen Situationen Standarddeutsch sprechen. Die Griechen lebten in einem Zustand der Diglossie seit der Spätantike, als sich im Byzantinischen Reich die Umgangssprache sehr weit von der Hochsprache entfernte, die sich nach wie vor an der klassischen Form des Griechischen aus Athen zu Platons Zeiten orientierte. Seit den Eroberungszügen Alexanders des Großen war Griechisch zur Verkehrssprache des ganzen östlichen Mittelmeerraums von Makedonien bis Ägypten geworden. Diese umgangssprachliche »Koiné«, deren wichtigstes literarisches Dokument das Neue Testament ist, war gegenüber dem klassischen Attisch schon deutlich einfacher. In der Zeit des Übergangs von der Antike zum Mittelalter durchlief die griechische Umgangssprache eine strukturell gleiche Entwicklung wie das Vulgärlatein in Westeuropa: Veränderungen der Aussprache und des Wortschatzes, Rückgang des Formenreichtums zugunsten präpositionaler und konjunktionaler Ausdrücke, Vereinfachung der Syntax.
So ist beispielsweise im umgangssprachlichen Mittelgriechisch der Dativ verschwunden: Die Ursache liegt darin, dass in der Aussprache die Unterscheidung der Vokallängen verloren ging und das End-ν bis zur Unhörbarkeit aufgeweicht wurde, so dass schließlich alltagssprachlich zwischen τὸν φίλον »den Freund« und τῷ φίλῳ »dem Freund« akustisch kein Unterschied mehr erkennbar war; der Dativ wurde präpositional mit dem Akkusativ εἰς τὸν φίλο(ν) umschrieben, im Neugriechischen schließlich verkürzt zu στὸ(ν) φίλο. Das Konjugationssystem durchlief radikale Änderungen: Das Futur und das Perfekt wurden mit Hilfsverben und Partikeln statt mit eigenen Konjugationen gebildet. Der neben dem Indikativ und Konjunktiv als eigener Modus zum Ausdruck von Wünschen dienende Optativ verschwand, das neben Aktiv und Passiv als dritte Diathese bestehende Medium verschmolz mit dem Passiv. Die in der ersten Person Singular mit -μι endenden »athematischen« Verben wurden in Deponentien auf -μαι umgebildet, aus εἰμί »ich bin« wurde εἶμαι. Eine Eigentümlichkeit, die das Neugriechische mit anderen Sprachen des südlichen Balkan teilt, ist das Verschwinden des Infinitivs, der durch einen Ausdruck mit Konjunktion ersetzt wurde: »Ich will gehen« heißt θέλω νὰ πάω, »ich will, dass ich gehe«.2
Das aus diesem tiefgreifenden Wandel hervorgegangene Neugriechisch hat sich vom Altgriechischen fast so weit entfernt wie die moderne romanische Sprachfamilie vom Lateinischen. Während jedoch in Westeuropa die aus den verschiedenen lokalen Varianten des Vulgärlatein entstandenen romanischen Volkssprachen sich im Mittelalter zu Kultursprachen emanzipierten, in denen Weltliteratur wie Dantes Divina commedia verfasst wurde, haben im Byzantinischen Reich die Gelehrten die Volkssprache unterdrückt. Altgriechisch blieb Staatssprache. Das Mittelgriechische ist relativ wenig dokumentiert, weil Volksliteratur vernichtet wurde. Nach dem Untergang des Byzantinischen Reichs blieb Altgriechisch im Patriarchat Konstantinopel die Sprache der orthodoxen Kirche, die das Volk nicht lesen und schreiben lernen ließ.
Sprachliche Entkolonisierung und Eliteherrschaft
Dass um 1800 den Gelehrten die neugriechische Umgangssprache als ungeeignet für die Bildung einer griechischen Nation erschien, hatte zwei Gründe: Zum einen glaubte man, im Sinne einer sprachlichen Entkolonisierung die vielen im Alltagsleben präsenten Lehnwörter tilgen zu müssen. Zum anderen sind im Neugriechischen durch grammatikalische Veränderungen allerhand Wörter entstanden, die in den Ohren der Gebildeten primitiv und unseriös klangen.
Im Übergang zum Neugriechischen ist bei maskulinen und femininen Nomina der ungleichsilbige dritte Deklinationstyp des Altgriechischen verschwunden. Es kam entweder zu einer Umbildung der Nominative oder zu einer Ersetzung durch andere Wörter oder zum Gebrauch von Diminutivwörtern. Aus dem altgriechischen ἡ πόλις, τῆς πόλεως für »die Stadt« wurde ἡ πόλη, τῆς πόλης. Für ὁ πατήρ, τοῦ πατρός, τὸν πατέρα »der Vater« wurde aus dem Akkusativ der neue Nominativ ὁ πατέρας mit dem Genitiv τοῦ πατέρα gebildet. Für »Hund« wurde ὁ κυῶν, τοῦ κυνός durch ὁ σκύλος, τοῦ σκύλου ersetzt. Völlig inakzeptabel aber war für die Puristen das Umgehen der nicht mehr existenten dritten Deklination durch regulär deklinierbare Diminutivformen: Für »Löwe« ὁ λέων wurde aus dem diminutivischen Neutrum τὸ λεοντάριον »das Löwchen« die verkürzte Form τὸ λιοντάρι gebildet, für »Schlange« ὁ ὄφις aus τὸ ὀφίδιον »das Schlänglein« kurz τὸ φίδι. Im Deutschen kennen wir den häufigen Gebrauch von Diminutiven vor allem in alemannischen Dialekten: Für Standarddeutsch-Sprecher klingen allerdings das »Häusle« des Schwaben oder das »Bergli« des Schweizers irgendwie komisch. Ähnlich albern muss es auf altsprachlich gebildete Griechen gewirkt haben, wenn respekteinflößende Tiere wie Löwe oder Schlange verniedlichend λιοντάρι oder φίδι heißen. In der Katharevousa wurden deshalb die altgriechischen Nomina einschließlich der dritten Deklination wiederhergestellt.
Angestoßen wurde die Entwicklung der Katharevousa durch Adamantios Koraïs, der als fortschrittlich und aufklärerisch eingestellter Intellektueller im Exil in Paris lebte. Ihm schwebte eine behutsame »Reinigung« des Neugriechischen vor: Die Zielvorstellung bestand in einem modernen Griechisch, wie es sich hypothetisch ohne fremde Einflüsse entwickelt hätte. Einigkeit bestand in der Auffassung, dass ein entkolonisiertes Griechisch in einer souveränen Nation einen möglichst rein griechischen Wortschatz verwenden sollte. In der Sphäre der Öffentlichkeit und der Institutionen ließ sich das durchsetzen: Man entschied, dass ein Minister nicht μινίστρος, sondern ὑπουργός heißen sollte, ein Soldat nicht σολδάτος, sondern στρατιώτης, die Familie nicht φαμέλια, sondern οἰκογένεια, ein Restaurant nicht ρεστοράν, sondern ἑστιατόριον. In der Sphäre des privaten Alltags aber blieben die Griechen renitent: Zu sehr waren die »Türkenwörter« ihnen in Fleisch und Blut übergegangen, als dass sie sich hätten beibringen lassen, für »Schuh« statt παπούτσι (vom türkischen pabuç) altgriechisch ὑπόδημα zu sagen. Auf dem Schild am Laden eines Obst- und Gemüsehändlers stand ὀπωροπώλης, »Obstverkäufer« als Neubildung aus dem Altgriechischen, aber umgangssprachlich ging und geht man nach wie vor zum μανάβης (vom türkischen manav). Nicht gräzisiert haben die Puristen allerdings Lehnwörter für alles »Ungriechische«: Natürlich hieß der Kommunismus auch bei Papadopoulos κομμουνισμός, das lateinische Wort sollte zeigen, dass es sich um etwas handelt, was nicht nach Griechenland gehört.
Die Katharevousa war niemals strikt vereinheitlicht. In ihrer einfachen Form (ἁπλὴ καθαρεύουσα), wie sie etwa in Zeitungen üblich war, behielt sie die neugriechische Syntax bei und ersetzte bloß die als ausländisch oder degeneriert empfundenen Vokabeln und Formen durch altgriechische. Die konservative Bildungselite, die bald nach der Unabhängigkeit die progressiven Reformer verdrängt hat, strebte allerdings danach, den Sprachduktus mehr und mehr dem Altgriechischen anzunähern. Die um 1930 in 24 Bänden erschienene Große griechische Enzyklopädie Μεγάλη Ἑλληνικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια verwendete exzessiv eine von der Umgangssprache sehr weit entfernte Katharevousa. Im Artikel über den Aufklärer und Sprachreformer Koraïs heißt es:
Ἡ δ’ ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος ἀποδημία του ἐγένετο πρόξενος πολλῶν ἀδίκων κρίσεων περὶ προσώπων καὶ πραγμάτων καὶ πρῶτα πρῶτα τῆς περὶ ἧς ἀνωτέρω ἔγινε λόγος πρὸς τὸν κλῆρον συμπεριφορᾶς του. Ἂν ἔζη ἐν Ἑλλάδι καὶ ἤρχετο εἰς ἐπικοινωνίαν πρὸς τὸν κλῆρον καὶ ἐγνώριζεν ἐκ τοῦ πλησίον ὄχι μόνον τὰς κακίας, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ, ὄχι μόνον πολὺ θὰ συνετέλει εἰς διόρθωσίν τινων ἐκ τῶν κακῶς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ δὲν θὰ ἤκουεν ὅσα ἤκουσεν ἐκ τῶν ὑπερβολικῶν κατὰ τοῦ κλήρου ἐκφράσεών του.3
»Seine Emigration aus Griechenland führte zu vielen ungerechten Urteilen über Personen und Sachverhalte und vor allem zu seinem oben beschriebenen Verhältnis zum Klerus. Hätte er in Griechenland gelebt und wäre er in Kontakt mit dem Klerus gekommen und hätte er aus der Nähe nicht nur dessen Missstände, sondern auch seine Tugenden gekannt, hätte er nicht nur viel zur Behebung mancher in der Kirche bestehender Übel beigetragen, er hätte auch nicht auf manches gehört, auf das er aufgrund seiner übermäßig antiklerikalen Ausrichtung hörte.«
Das ist nicht das behutsam korrigierte und von den sprachlichen Spuren der Fremdherrschaft gereinigte Neugriechisch, das Koraïs in Sinne hatte, sondern fast schon Altgriechisch. Ausgiebig werden die im Altgriechischen wichtige, in modernen Kontexten oft geschraubt klingende attributive Wortstellung oder Partizipialkonstruktionen gebraucht, und der im Mittelalter verschwundene Dativ ist auch wieder da: τῆς περὶ ἧς ἀνωτέρω ἔγινε λόγος πρὸς τὸν κλῆρον συμπεριφορᾶς oder τινων ἐκ τῶν κακῶς ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐχόντων dürfte für den durchschnittlichen griechischen Leser dunkel, geschwollen und snobistisch geklungen haben.
Papadopoulos hat einen solchen Sprachstil gezielt als Herrschaftsmittel eingesetzt: 1968 legte er dem Volk einen Verfassungsentwurf zur »Diskussion« vor, der für die breite Mehrheit unverständlich war. Artikel 2 Satz 2 lautete:
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, κεφαλὴν γνωρίζουσα τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὑπάρχει ἀναποστάστως ἡνωμένη δογματικῶς μετὰ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης καὶ πάσης ὁμοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.4
»Die Orthodoxe Kirche Griechenlands, die als Haupt unseren Herrn Jesus Christus anerkennt, besteht in unzertrennlicher Einheit der Lehre mit der Großen Kirche in Konstantinopel und jeder Kirche Christi gleichen Glaubens.«
Diesen Satz kannte man, er war bereits in früheren Verfassungen enthalten. Wo es um den orthodoxen Glauben geht, der für die nationale Identität der Griechen ähnlich konstitutiv ist wie der Katholizismus in Polen, ist man in Griechenland einen archaischen Sprachstil gewohnt. Übersetzungen des Neuen Testaments aus der originalen Koiné ins Neugriechische hat die Kirche nur sehr zögerlich akzeptiert, und die Allgegenwart der Kirche mit ihrer altgriechischen Liturgie bewirkt, dass auch Griechen ohne Gymnasialbildung ein gewisses Grundverständnis von Altgriechisch als Sakralsprache haben. Zwei Dutzend Druckseiten über weltliche Angelegenheiten in einem solchen Stil werden die meisten Normalbürger allerdings überfordert haben.
Nach dem Sturz der Diktatur und der endgültigen Abschaffung der Monarchie wurde auch die neue, mit einigen Änderungen bis heute gültige Verfassung von 1975 in Katharevousa formuliert. 1976 schließlich wurde durch ein (selbst noch in Katharevousa geschriebenes) Bildungsreformgesetz die Katharevousa aus den Schulen verbannt. Seither ist eine Generation herangewachsen, die Texte in Katharevousa kaum noch versteht. An ihre Stelle trat ein Standard-Neugriechisch, das die Volkssprache auf ein hochsprachliches Niveau hebt, ihren in der Neuzeit gewachsenen multiethnischen Wortschatz anerkennt, aber als differenzierendes Stilmittel des gehobenen Sprachgebrauchs andererseits auch altsprachliche Einschlüsse beibehält. Den letzten Reformschritt vollzog 1982 die sozialistische Regierung unter Andreas Papandreou, indem sie das von den konservativen Vorgängern nicht angetastete polytonische Akzentsystem abschaffte. Die aus dem Altgriechischen stammenden komplizierten Diakritika mit den drei Prosodieakzenten Akut, Gravis und Zirkumflex, zwei Zeichen für aspirierte oder nicht aspirierte Anlaute und dem stummen iota subscriptum zur Markierung bestimmter grammatikalischer Formen sind im Neugriechischen dysfunktional: In der realen Aussprache haben sie schon seit der Spätantike keine Bedeutung mehr. Die verschiedenen Akzentzeichen wurden von byzantinischen Gelehrten entwickelt, um etymologische Informationen, die in der Aussprache verloren gegangen sind, in der Schreibweise aufzubewahren. Im Neugriechischen haben sie einen erheblichen Lernaufwand ohne praktischen Nutzen verursacht. Seit 1982 schreibt man nur noch einen einheitlichen Akzent, der die tatsächliche Aussprache wiedergibt. Beibehalten wurde die polytonische Schreibweise von wenigen konservativen und kirchlichen Verlagen; die traditionsreiche bildungsbürgerliche Tageszeitung Ἑστία verwendet eine seit der Einführung von Schreibmaschinen gebräuchliche, etwas vereinfachte Variante, die den Gravis-Akzent durch den Akut ersetzt.
Emanzipation und feine Unterschiede
Die Emanzipation der Volkssprache, die in den westeuropäischen Gebieten des einstigen römischen Reichs im Mittelalter erfolgt ist, kam in Griechenland also erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Gang, als eine volkssprachliche Literatur entstand. Amtliche Anerkennung fand die Dimotiki aber erst 1976. Erst seit knapp fünfzig Jahren sind in Griechenland die Gesetzestexte des Staates in der Sprache des Volkes formuliert. Selbst die extrem konservative orthodoxe Kirche hat sich der neuen Realität anpassen müssen und verwendet Katharevousa nur noch in internen Dokumenten und für Texte, die dem Austausch mit anderen orthodoxen Kirchen dienen. Tatsächlich bestand der interkulturelle Vorteil der Katharevousa darin, dass sie für Nichtgriechen, die des Altgriechischen mächtig sind – also etwa Theologen und Philosophen – recht gut verständlich ist. In der orthodoxen Welt mag die Katharevousa unter Gelehrten bisweilen noch die Funktion einer lingua franca haben.
Die Verfassung von 1975 ist natürlich in die neue Standardsprache übersetzt worden. Der oben zitierte Satz über die orthodoxe Kirche ist in ihrem Artikel 3 übrigens nach wie vor enthalten. Er lautet jetzt:
H Oρθόδoξη Eκκλησία της Eλλάδας, πoυ γνωρίζει κεφαλή της τoν Kύριo ημών Iησoύ Xριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δoγματικά με τη Mεγάλη Eκκλησία της Kωνσταντινoύπoλης και με κάθε άλλη oμόδoξη Eκκλησία τoυ Xριστoύ …5
Bei gleicher Aussage liest sich das wesentlich unverkrampfter als in Katharevousa. Dabei fällt auf: Wenn von unserem Herrn Jesus Christus die Rede ist, wird für »unser« auch im Kontext der Dimotiki das altgriechische ἡμῶν verwendet – das neugriechische μας würde für Christus wohl zu trivial klingen. Nicht nur im sakralen Bereich, auch im institutionellen Sektor finden sich Einschlüsse aus dem Altgriechischen. Das altgriechische πόλις für »Stadt« war, wie oben beschrieben, im Neugriechischen aus grammatikalischen Gründen zu πόλη umgebildet worden. Ein Stadtplan heißt χάρτης πόλης, ein städtisches Krankenhaus jedoch νοσοκομείο πόλεως: Wenn nicht von der Stadt im gegenständlichen Sinne als Ansammlung von Häusern die Rede ist, sondern von der Stadt als Institution, findet diese Unterscheidung ihren Ausdruck im altgriechischen Genitiv. Für »Haus« im Sinne einer Wohnstätte war schon in der Römerzeit statt des klassischen οἶκος das vom lateinischen hospitium entlehnte ὁσπίτιον in Gebrauch gekommen, neugriechisch verkürzt zu σπίτι, während οίκος ein Haus als Institution bezeichnet – etwa εκδοτικός οίκος für ein Verlagshaus. So wie wir im Deutschen für abstrakte Gegenstände und Konzepte häufig lateinische oder griechische Wörter verwenden, markiert im Neugriechischen der altgriechische Wortschatz ein höheres Abstraktionsniveau. Auch in zahlreichen Redewendungen haben aus dem Altgriechischen stammende Ausdrücke sich erhalten: etwa εντάξει für »in Ordnung«, hier hat der Dativ überlebt.
Natürlich kann die Verwendung altgriechischer Einschlüsse auch als Mittel der soziolektalen Distinktion dienen. Wer »über das Thema …« sprechen und dabei vornehm und gebildet klingen möchte, kann statt des schlichten για το θέμα auch περί του θέματος sagen. Aus dem Altgriechischen ist vermittels der Katharevousa ein Reservoir erhalten geblieben, das für den Wechsel in ein gehobenes Sprachregister zur Verfügung steht und in ein System der feinen Unterschiede einfließt. Antikisierende Wendungen können als Stilmittel der Emphase dienen. So bei Konstantinos Kavafis, einem der ganz Großen der neugriechischen Literatur, in seinem Gedicht Νὰ μείνει (»Um zu bleiben«):
Ἡ ὥρα μιὰ τὴν νύχτα θάτανε
ἢ μιάμισυ.
Σὲ μιὰ γωνιὰ τοῦ καπηλειοῦ·
πίσω ἀπ’ τὸ ξύλινο τὸ χώρισμα.
Ἐκτὸς ἡμῶν τῶν δυὸ τὸ μαγαζὶ ὅλως διόλου ἄδειο.
Μιὰ λάμπα πετρελαίου μόλις τὸ φώτιζε.
Κοιμούντανε, στὴν πόρτα, ὁ ἀγρυπνισμένος ὑπηρέτης.
»Ein Uhr in der Nacht war es wohl
oder halb zwei.
In einer Ecke der Taverne;
hinter der hölzernen Trennwand.
Außer uns zweien sonst niemand mehr in dem Raum.
Eine Petroleumlampe gab ihm kaum Licht.
Schlafend, in der Tür, der erschöpfte Kellner.«6
Das »außer uns zweien«, umgangssprachlich εκτός από εμάς τους δύο, wird durch Verwendung des altgriechischen, in religiösen Zusammenhängen gebräuchlichen ἡμῶν in einer nicht übersetzbaren Weise hervorgehoben, der Wechsel des Sprachregisters setzt das Liebespaar in Kontrast zur profanen Umgebung.
In einem Artikel der griechischen Wikipedia finden wir die Formulierung:
… προωθήθηκε από το περιοδικό «Αντί» το 1983 το οποίο αυτοχαρακτηριζόμενο ως «Πολιτική και Πολιτιστική Επιθεώρηση» ήταν το κύριο μέσο έκφρασης της εκτός του ΚΚΕ αριστεράς.7
»Sie wurde 1983 von der Zeitschrift ›Anti‹ gefördert, welche sich selbst als ›politisches und kulturelles Magazin‹ charakterisierte und das wichtigste Medium der Linken außerhalb der KKE (Kommunistische Partei Griechenlands) war.«
Das ist ein Beispiel für einen gehobenen, eleganten neugriechischen Stil, der mit der Partizipialkonstruktion αυτοχαρακτηριζόμενο und mit der attributiven Wortstellung in της εκτός του ΚΚΕ αριστεράς dezente Anleihen beim altgriechischen Satzbau macht, ohne gekünstelt oder dunkel zu wirken.
Die Katharevousa war aus dem Erfordernis entstanden, für ein Volk von Analphabeten nach jahrhundertelanger Fremdherrschaft eine Hochsprache zu schaffen: Sie diente der nationalen Emanzipation. Für die herrschende Klasse des neuen Nationalstaats wurde sie jedoch zum Herrschaftsinstrument. Heute wäre Adamantios Koraïs wahrscheinlich mit dem im 20. Jahrhundert entstandenen Standard-Neugriechisch zufrieden: In ihm hat die Volkssprache sich emanzipiert und zur Hochsprache entwickelt, indem sie einen gehobenen Wortschatz und Stilelemente eines formelleren Sprachregisters in sich aufnahm. In diesem Sinne setzt sie den ursprünglichen emanzipatorischen Ansatz der Katharevousa von Koraïs ohne Purismus fort und führt das Beste aus den beiden Welten der Volkssprache und der klassisch geschulten Bildungssprache zu einer an Ausdrucksnuancen außerordentlich reichen Synthese zusammen. Historisch hatte die Katharevousa eine Brückenfunktion, die das ermöglicht hat.
-
Ομιλία Γεωργίου Παπαδόπουλου 1967 (Rede von Georgios Papadopoulos, 27. April 1967), https://youtu.be/YopZeSZWXK4?feature=shared&t=86. ↩︎
-
Erhalten geblieben ist der altgriechische Infinitiv nur in dem Romeyka-Dialekt, der an der türkischen Schwarzmeerküste noch von wenigen tausend Pontosgriechen islamischen Glaubens gesprochen wird, die von dem 1923 zwischen der Türkei und Griechenland vereinbarten Bevölkerungsaustausch ausgenommen waren. Das aus heutiger Sicht grauenhaft anmutende Umsiedlungsprogramm sah vor, dass etwa 1,2 Millionen griechische Christen die Türkei verlassen mussten, während umgekehrt 400 000 Muslime aus Griechenland in die Türkei geschickt wurden. ↩︎
-
Zit. n. Artikel »Katharevousa« in der englischen Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Katharevousa. ↩︎
-
Ἐφημερὶς τῆς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος (Journal der Regierung des Königreichs Griechenland), 267, 15. November 1968, S. 2031. ↩︎
-
Σύνταγμα της Ελλάδας (Verfassung Griechenlands), Βουλή των Ελλήνων 2013, S. 19. ↩︎
-
In: Από πού έρχεστε; Νεοελληνική Συλλογή (Woher kommt ihr? Neugriechisches Lesebuch), hg. v. Efrossini Kalkasina und Elisabeth Weiler, München 2001, S. 62f., Übersetzung von Michael Schroeder. ↩︎
-
Artikel Νεορθοδοξία, https://el.wikipedia.org/wiki/Νεορθοδοξία. ↩︎