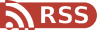Vom Recht, man selbst zu bleiben
Vor zehn Jahren, am 19. Juli 2014, starb in Frankfurt 92-jährig der seinerzeit sehr bekannte Politologe Iring Fetscher. Er verkörperte einen Typ von Linksliberalen, den es heute nicht mehr gibt. Heute wäre er linkskonservativ.
Wer in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts aufwuchs und sich für politische Theorien der Linken interessierte, kam an ihm nicht vorbei: Für meine Generation war Iring Fetscher der Marx-Erklärer. In meiner Schulzeit las ich Bücher von Fetscher. Als akademischer Lehrer war er eine liebenswürdige, freundliche Erscheinung, auch wenn ich manche Wortgefechte mit ihm hatte.
Fetscher entstammte privilegierten Verhältnissen. Sein linksliberal eingestellter Vater Rainer Fetscher, 1945 am Tag der Kapitulation auf offener Straße erschossen, war Mediziner mit Professur in Dresden und beschäftigte sich mit Eugenik zu Zeiten, als das nicht nur Rechte, sondern auch Sozialdemokraten taten; ob er der Antifaschist und Unterstützer des Widerstands war, als der er in der DDR gewürdigt wurde, oder ein Wasserträger der Nazis, ist ebenso umstritten wie die Frage, wer am 8. Mai auf ihn geschossen hat. Iring Fetscher konvertierte nach dem Krieg vom Protestantismus zum Katholizismus, weil Thomas von Aquins gratia non tollit naturam, sed perficit ihm menschenfreundlicher erschien als Luthers Irrationalismus. Als Politologe widmete er sich seit den 1950er Jahren vor allem dem im Adenauerstaat verteufelten und tabuisierten Denken von Karl Marx. Natürlich tat er das mit antikommunistischer Akzentsetzung, indem er in der für linksbürgerliche Marx-Adepten typischen Weise vor allem den entfremdungskritischen Humanismus des frühen Marx hervorhob und gegen den realen Sozialismus ausspielte. Dennoch hat er damit ein Tor aufgestoßen. Seine wichtigste Publikation war sicher seine Textsammlung »Der Marxismus« (1963–68), in der er mit einer Zusammenstellung sonst schwer auffindbarer Quellen Positionen von Marx und Engels und ihre Rezeption bis in die Zeit der Oktoberrevolution dokumentierte: Die Debatten in der klassischen Periode der Sozialdemokratie und des frühen Bolschewismus über Orthodoxie und Revisionismus, ökonomische, philosophische und politische Fragen wurden damit in kompakter Form einem breiten Publikum zugänglich. Sein auflagenstärkstes Buch hingegen dürfte das »Wer hat Dornröschen wachgeküsst?« betitelte »Märchenverwirrbuch« (1972) gewesen sein, in dem er Grimms Märchen humoristisch einer marxistischen und psychoanalytischen Interpretation unterzog: So war damals der Zeitgeist.
In der Sozialdemokratie stand er in hohem Ansehen. Er beriet die beiden Kanzler der sozialliberalen Ära, wobei er sich mit Brandt ganz gut verstanden haben dürfte, mit Schmidt vermutlich eher nicht. Als Mitglied der Grundwertekommission der SPD stand er Erhard Eppler nahe: also dem von Ökologie und neuen sozialen Bewegungen angehauchten »Kirchentags-Flügel«, der vom traditionellen Wachstumsfetischismus abrückte und eine »neue Lebensqualität« anstrebte. Zu erinnern ist daran, dass solche Positionen damals auch der junge Oskar Lafontaine vertrat. Das beinhaltete keinesfalls Nachgiebigkeit in der Verteidigung des Sozialstaats. 1994 unterstützte Fetscher gegen den in die Offensive gehenden Neoliberalismus die von dem Jesuiten Oswald von Nell-Breuning initiierte Erklärung »Solidarität am Standort Deutschland«. In diesem Zusammenhang fand er im taz-Interview mit Bascha Mika hellsichtige Worte:
»Man könnte auch sagen, daß die Angst vor dem Kommunismus fehlt, die früher doch einige Unternehmer zur Vernunft gebracht hat. Pfleiderer, der ehemalige Präsident der Landesbank Stuttgart, sagte es so: ›Ha noi, ohne die Kommunischtefurcht hättet mir kein Sozialstaat gekriegt!‹ Jetzt gibt es ihn nicht mehr, woraus wohl manche in den Wirtschaftsetagen die falsche Schlußfolgerung ziehen: Da braucht man auch den Sozialstaat nicht mehr.«1
Zwischen Fetscher und Hartz-IV-Sozialdemokraten wie seinem Meisterschüler Herfried Münkler (von dem ich vor allem seine Arroganz in Erinnerung habe: »Sollten Sie das Glück haben, Machiavellis Principe ganz gelesen zu haben …«) lagen Welten. Fetscher verkörperte einen Typus von Linksliberalen, bei denen ein Wertefundament aus dem untergegangenen Bildungsbürgertum eine gewisse Unnachgiebigkeit in der Grundhaltung sicherte. Das aber bewirkte auch, dass Fetscher keine Probleme im Umgang mit Andersdenkenden hatte: Er hat regelmäßig auch mit dem konservativen Philosophen Günter Rohrmoser zusammengearbeitet. Heute würde Rohrmoser vermutlich der cancel culture zum Opfer fallen, und Fetscher würde wegen »Kontaktschuld« an den Pranger gestellt.
So unzeitgemäß Fetscher aus heutiger Sicht erscheint, so herausfordernd aktuell ist ein Essay, den er 1973 in der Zeitschrift Merkur veröffentlichte: »Konservative Reflexionen eines Nicht-Konservativen«.2 Fetscher wirft in der Einleitung die Frage auf:
»Geht man nur davon aus, daß jeder Konservativismus nichts andres ist als eine mehr oder minder geschickte Rechtfertigung des Status Quo, der durch Massenforderungen bedroht wird, dann kann es nur eine konservative »Ideologie« geben, keine legitime und allgemein – für alle Glieder der Gesellschaft gültige und verständliche – konservative Theorie.
Aber ist das so und muß das so sein?« (S. 911)
Und er gibt die Antwort:
»Es müßte nur dann so sein, wenn
1. durch die industriell-kapitalistische (und industriell-bürokratisch-sozialistische) Entwicklung lediglich Interessen von privilegierten Minderheiten bedroht würden, oder wenn die Bedrohung dieser Minderheits-Interessen das einzige wäre, was konservativen Theorien am Herzen läge;
2. wenn nicht auch oder sogar vorwiegend Verhältnisse, Haltungen, ›Werte‹ in Gefahr stünden, von deren Existenz die ›Qualität des Lebens‹ der Gesamtbevölkerung in hohem Maße abhängig ist. Wäre das nämlich der Fall, dann könnte es durchaus einen ›demokratischen Konservatismus‹ geben in einem Sinne, der weit über den bloßen Hinweis auf den Respekt vor demokratischen Institutionen hinausgeht, den man mit einer solchen Bezeichnung vielleicht verbindet.« (Ebd.)
Die Erhaltung der Grundlagen der »›Qualität des Lebens‹ der Gesamtbevölkerung« hat eine natürliche und eine kulturelle Dimension. Ökologie gilt heute als Thema der »Progressiven«, der Linken, während »Konservative« sich vornehmlich der Bewahrung des Verbrennungsmotors verschrieben haben. Ökologie verlangt uns Veränderungen ab: Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit, und die besagt, dass wir als Gesellschaft nicht einfach so weitermachen können wie bisher. Konservative, die glauben, dass der Markt alles regelt, wehren Herausforderungen, die staatliche Intervention und supranationale Koordination erfordern, durch Leugnung ab, zweifeln den Klimawandel an. Vor fünfzig Jahren hingegen war der Pionier der Ökologie in der Bundesrepublik Deutschland der CDU-Politiker Herbert Gruhl, am Parteibildungsprozess der Grünen waren nicht wenige Konservative beteiligt. Zur »›Umwelt‹, die ein ontologischer Bestandteil menschlichen Daseins ist«, rechnet Fetscher indes »nicht nur die Natur, sondern auch die Kultur in ihren individuellen Ausprägungen und Traditionen« (S. 919). Auf diesem Gebiet fällt unsere postindustrielle, grün gewordene Linke vor allem durch den geradezu religiösen Fanatismus ihres cultural engineering auf, mit dem sie alles Gewachsene und Tradierte, in dem Menschen sich wiedererkennen und solidarisieren, zu zerstören und durch artifizielle Konstrukte zu ersetzen trachtet.
Fetscher argumentiert: Menschen haben ein Recht auf Veränderung, das die linke Theologin Dorothee Sölle das »Recht, ein anderer zu werden« nannte. Komplementär dazu aber haben Menschen auch ein »Recht, man selbst zu bleiben«. Er verweist auf die damals in Norwegen geführte Diskussion über einen Beitritt zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, die durch Referendum ablehnend entschieden wurde: Widerstand gegen einen EWG-Eintritt ging vor allem von der ländlichen Bevölkerung im Norden des Landes aus, von Fischern, die lieber nach alter Väter Sitte als Selbstständige auf ihren Booten zur See fuhren, als zu Lohnarbeitern auf Fabrikschiffen irgendeines Megakonzerns degradiert zu werden, womit sie vielleicht mehr verdient, aber ihre Autonomie eingebüßt hätten. Diese »rückständigen«, »konservativen« Fischer fanden Unterstützung aus den Reihen der norwegischen Linken.
Fetscher schwebte eine Politik vor, die diesen beiden Rechten, dem »Recht, ein anderer zu werden« und dem »Recht, man selbst zu bleiben«, gleichen Rang in demokratischer Aushandlung und Abwägung einräumt. Heute hingegen erleben wir, wie die kraft ihrer Kontrolle über die veröffentlichte Meinung zur hegemonialen Fraktion der herrschenden Klasse aufgestiegene neue Mittelschicht dem »Recht, ein anderer zu werden« einen absoluten, unantastbaren Wert zuschreibt und zugleich systematisch die Entwertung der Lebensweisen und Lebenserfahrungen der Arbeiterschaft und alten Mittelschicht betreibt. Ein wachsender Teil der Bevölkerung sieht sein »Recht, man selbst zu bleiben« angegriffen und in Frage gestellt. Das ist der Nährboden des Rechtspopulismus.
»Was das ›Wesen des Menschen‹ ausmacht, ist historisch wandelbar, wir wissen es. Aber ebenso, daß dieser Wandel, in dem ›das Recht ein anderer zu werden‹ seinen Ausdruck findet, auch zerstören kann und je und je zerstört hat. Marx konnte die Zerstörung als unvermeidlichen Aspekt eines dialektischen Fortschrittsprozesses deuten und hinnehmen. In einer Zeit, da es Mittel gibt, durch die sich die Menschheit selbst zerstören kann, und da der ›Fortschritt‹ in Anführungszeichen geschrieben werden muß, weil er mehr zu zerstören beginnt als er an Vorteilen bringt – in solcher Zeit ist es notwendig, auch das ins Auge zu fassen, von dem wir wünschen, daß es nicht verlorengeht.« (S. 919)
Heute stellt sich deshalb die Frage nach anderen politischen Allianzen als denen des 20. Jahrhunderts, als die soziale Emanzipation des Menschen vom Objekt zum Subjekt der Geschichte noch eindeutig dem »Fortschritt« zuzuordnen schien. Die Verhältnisse sind komplexer. Iring Fetscher wäre heute wohl linkskonservativ.
-
Mangelt es an Kommunistenfurcht? Der Politologe Iring Fetscher zur Erklärung der SozialwissenschaftlerInnen über den Standort Deutschland, taz vom 20. Mai 1994, https://taz.de/!1561837/. ↩︎
-
In: Merkur Nr. 305, Oktober 1973, S. 911-919, Volltext auch unter https://www.merkur-zeitschrift.de/iring-fetscher-konservative-reflexionen-eines-nicht-konservativen/. ↩︎