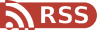Ist Wotan ein Putin-Troll?
Festspielzeit in Bayreuth: Wie in den letzten zwei Jahren singt auch diesmal wieder der Bassbariton Tomasz Konieczny den Wotan in der kontroversen Ring-Inszenierung von Valentin Schwarz. Hier soll es aber nicht um Koniecznys schwer anhörbares Dauertremolo gehen, sondern um ein Fundstück, das den Sänger in die Bredouille bringen könnte. Als der in Łódź geborene Wagner-Interpret vor einigen Jahren einer Kollegin ein Interview gab und darin auch über Politik sprach, konnte er nicht ahnen, welchen Strick man ihm heute daraus drehen könnte.
What’s Opera Doc ist ein Youtube-Kanal von Sängern für Sänger. Dort geht es um Oper und Gesang, die Arbeitsbedingungen an Theatern, Ärger mit selbstherrlichen Regisseuren und Ähnliches. 2017 gab es dort ein Gespräch mit Tomasz Konieczny. Er war damals erfolgreich an der Wiener Staatsoper, aber noch kein Bayreuth-Star, auf dem »Grünen Hügel« debütierte er erst ein Jahr später in der gefürchteten Stimmenkiller-Partie des Telramund im Lohengrin. Der größte Teil der halbstündigen Unterredung dreht sich um seine Karriere und seine Ansichten über Regie. Im letzten Drittel kommt er dann auf die politische Situation in seinem Heimatland Polen zu sprechen. Konieczny äußert sich zutiefst besorgt über die autoritären Tendenzen der damaligen rechtskonservativen Regierung (bei der es sich seiner Meinung nach um »Bolschewiken« handelte). Er fügt dem einen Querverweis auf die Ukraine hinzu, wo eine ähnliche Spaltung der Gesellschaft betrieben werde. Allerdings seien die Verhältnisse dort nicht ganz mit Polen vergleichbar, da in der Ukraine die Hälfte der Bevölkerung Russisch spricht, das seien ja tatsächlich Russen, anders als Polen sei die Ukraine ein »künstlich entstandenes« Land.
Au weia. Wenn sich das in Kiew herumspricht, landet Konieczny demnächst auf der berüchtigten Schwarzen Liste der »Informationsterroristen«, die »russische Narrative« verbreiten. Die Ukraine ein »künstlich entstandenes« Land, wo lauter Russen leben? Was von Rosa Luxemburg bis Helmut Schmidt common sense und 2017 noch ziemlich unkontrovers war, gilt heute als »Putin-Propaganda«, zu deren »Widerlegung« ein Geschwader von Historikern und Slawistikprofessoren mobilisiert wird. (Also solche Leute wie Prof. Dr. Karl Schlögel, bis 1980 regelmäßiger Autor der Roten Fahne der maoistischen »KPD«, die den »Sozialimperialismus« von Breschnew für den Hauptfeind hielt und deshalb generös der Bundeswehr ihre Zusammenarbeit anbot.)
Dabei hat man in Polen, dessen südöstliche Grenze vor 1772 kurz vor Kiew verlief, ja ganz eigene Gründe, sauer auf Stalin zu sein, der ein Territorium, dessen staatliche Zugehörigkeit im Laufe der Geschichte etliche Male wechselte, der Ukraine zugewiesen hat. Darunter die einst blühend multikulturelle Bukowina mit ihrer sprachlichen Vielfalt aus Rumänisch, Polnisch, Jiddisch, Deutsch und Ukrainisch. Die Generation, deren Großeltern noch erlebt haben, dass vor dem Zweiten Weltkrieg die Bevölkerung der Ukraine – grob vereinfacht – aus ukrainischen Bauern, russischen Industriearbeitern, polnischer Intelligenz und jüdischen Kaufleuten bestand, dass die ethnische Frage zugleich eine soziale war und dass der in der heutigen Ukraine gefeierte Held Bandera das Ziel einer durchgreifenden Ukrainisierung eben nur in Zusammenarbeit mit den Nazis verfolgen konnte, stirbt aus. Damit schlägt die Stunde der »Osteuropa-Experten«, die mit dem interessegeleiteten Recycling alter Mythen aus der Mottenkiste der Kosaken die Forderung nach Aufnahme der Ukraine in die NATO untermauern. Wenn von diesen Experten nun bewiesen ist, dass es sich bei den Ansichten von Tomasz Konieczny, der als liberaler Pole für Putin zweifellos nicht die geringste Sympathie hegt, um ein »Kreml-Narrativ« und »Putin-Propaganda« handelt, stellt sich die Frage: Bekommt Konieczny demnächst in Bayreuth Auftrittsverbot?
Zurück zur Oper und vom »russischen Narrativ« zu dem unserer einheimischen Kulturelite: Kurz nach der russischen Invasion im Februar 2022 sendete der Hessische Rundfunk in seinem Kulturprogramm HR2 (einst berühmt für die legendären Abendstudio-Sendungen, wo Adorno Vorträge ohne Manuskript halten durfte) eine Aufzeichnung von Jacques Offenbachs Les contes d’Hoffmann aus dem Nationaltheater Kiew – im französischen Original, was als Ausdruck der »Weltoffenheit« der unabhängigen Ukraine gedeutet wurde. In einer redaktionellen Ankündigung hieß es, dass in der Sowjetunion seit Mitte der 1920er Jahre auf Anordnung des zuständigen Volkskommissars Opern in Kiew nur auf Ukrainisch aufgeführt wurden. Damit wurde insinuiert, die Bolschewiken hätten so die Ukraine provinzialisieren und von Europa abschotten wollen. Also, die Sowjets haben ja die Ukrainer ganz schlimm unterdrückt. Aus dem Klassiksender war zu erfahren, dass im Theater die Unterdrückung darin bestand, Opern auf Ukrainisch zu singen.
Bei dem Volkskommissar handelte es sich um Oleksandr Shumsky, der im Sinne der Leninschen Nationalitätenpolitik die Verwendung der ukrainischen Sprache förderte und 1927 nach Stalins Kurswechsel abgesetzt wurde. Trotz Stalins Schwenk in Richtung auf eine stärkere Russifizierung wurde 1939 das Kiewer Opernhaus nach dem ukrainischen Nationaldichter Taras Schewtschenko (1814–1861) benannt. Im Zarenreich für seinen Gebrauch des ukrainischen »Bauerndialekts« kritisiert und als Umstürzler politisch verfolgt, wurde er in der Sowjetunion hoch in Ehren gehalten. Ein ganzes Stadtviertel von Kiew trägt seit 1937 seinen Namen, und im Schewtschenko-Park wurde ihm zum 125. Geburtstag ein Denkmal errichtet. Wenn das Märchen wahr wäre, wonach Stalin die Ukraine vernichten wollte, dann wären die Ehrbezeugungen für den noch als Leibeigener aufgewachsenen Bauernsohn, der den Grundstein der ukrainischen Literatur legte, eine ziemlich blöde Idee gewesen.
Aber egal was die Bolschewiken gemacht haben, es war immer falsch: Wenn sie in Kiew deutsche, italienische und französische Opern auf Ukrainisch singen ließen, dann finden kosmopolitische Kulturradioredakteure aus der neuen Mittelschicht das provinziell. Dabei war es in ganz Europa bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts üblich, Opern in die Landessprache zu übersetzen. In Berlin oder Wien hörte man bis in die 1950er Jahre selbstverständlich Figaros Hochzeit, Die Macht des Schicksals oder Hoffmanns Erzählungen auf Deutsch, an kleineren Bühnen noch viel länger. Ebenso selbstverständlich sang man in Rom oder Mailand Wagner auf Italienisch und in Paris Mozart und Verdi auf Französisch. In Prag und Budapest dominierte vor dem Zweiten Weltkrieg noch Deutsch; 1945 ging man dort zu Tschechisch und Ungarisch über, damit Oper auch für ein nicht dem deutschsprachig sozialisierten k.u.k. Bildungsbürgertum angehöriges Publikum verständlich wurde. Landessprache war fortschrittlich und demokratisch. Aus Budapest sind Mitschnitte von Aufführungen erhalten, die Otto Klemperer zwischen 1946 und 1951 dirigierte: faszinierende Tondokumente in einer für uns sehr fremd klingenden Sprache, aber auch auf Ungarisch beeindruckt sein Fidelio mit einem revolutionären Furor, der betulichen Berliner und Wiener Kapellmeistern abging.
Opernaufführungen in Originalsprache waren vor 1950 nur in Nord- und Südamerika die Regel, wo der Musikbetrieb von Auswanderern und Emigranten getragen wurde. In Westeuropa war nach dem Zweiten Weltkrieg der allmähliche Übergang zur Originalsprache ein Resultat der Internationalisierung des Betriebs. Manche ehemalige DDR-Bürger indes erinnern sich gerne daran, dass man in Zeiten, wo die heute übliche Übertitelung technisch noch nicht machbar war, in Ost-Berlin und Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt alle Opern auf Deutsch hören konnte. In Osteuropa hielten die Originalsprachen nach 1990 Einzug, als die Übertitelung mit Übersetzung möglich wurde: Dieser Wandel vollzog sich nicht nur in Kiew, sondern auch in Moskau und St. Petersburg.
Stalins Lieblingssänger war übrigens Iwan Koslowsky, ein ukrainischer Bauernsohn aus Wassylkiw bei Kiew. In der Sowjetunion wurde er frenetisch gefeiert, eine internationale Karriere blieb dem Tenor mit phänomenaler Belcanto-Qualität versagt, weil Stalin ihn nicht ausreisen ließ. In einer Aufnahme des Moskauer Rundfunks von 1949 ist er als gleißender Lohengrin zu hören – auf Russisch. So gut singt das in Bayreuth heute niemand.