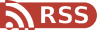Tücken der Semantik
Am 6. Mai 2024 schrieb Friedrich Merz auf X:
»Wir wollen das sogenannte ›Bürgergeld‹ abschaffen. Schon der Name klingt viel zu sehr nach bedingungslosem Grundeinkommen. Wir wollen stattdessen eine neue Grundsicherung, die denen hilft, die Hilfe benötigen, aber auch Anreize schafft für diejenigen, die arbeiten können.«
Da müsste Merz sich zuallererst bei der FDP beschweren. Sie war die erste Partei, die schon vor dreißig Jahren die Forderung nach einem »Bürgergeld« erhob. Auch in der CDU gab es zeitweilig Stimmen, die in »Bürgergeld« ein Zukunftsmodell sahen. Herr Merz, wie wäre es mit einer Protestmail an einen alten Parteifreund aus Thüringen? Formulierungshilfe: »Hey Dieter, altes Haus, was hast du damals für einen Bockmist gemacht …«
Tatsächlich ist das »liberale Bürgergeld«, das die FDP sich 1994 ins Programm schrieb, eine abgeschwächte Variante des »bedingungslosen Grundeinkommens«, für das schon 1962 der radikal marktliberale Ökonom Milton Friedman plädierte. In Deutschland hat dieses Konzept zuerst 1985 der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Mitschke vertreten. Beim »liberalen Bürgergeld« handelt es sich um eine Art »negative Einkommensteuer«, die vom Finanzamt ausgezahlt wird, allerdings nicht bedingungslos, sondern gebunden an eine Überprüfung der Bedürftigkeit. Das hat die FDP auch auf ihrem Parteitag 2005 erneut beschlossen und im Bundestagswahlkampf propagiert. Als durchschnittliche monatliche Höhe für eine alleinstehende Person waren 662 Euro angesetzt. Davon konnte man auch damals in keiner größeren Stadt leben. Ähnliche Vorschläge unterbreitete der thüringische CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsident Dieter Althaus. Das von ihm beworbene »solidarische Bürgergeld« sollte sogar tatsächlich bedingungslos sein. Bei beiden Versionen von »Bürgergeld« handelte es sich um eine durch und durch neoliberale Konzeption, die vor allem einer Verschlankung und Vereinfachung des Sozialsystems dienen sollte. Natürlich wäre es auf eine Verschlechterung für die Leistungsempfänger hinausgelaufen, die dann gezwungen gewesen wären, zusätzlich schlecht bezahlte Arbeit aufzunehmen. Beabsichtigt war eine Subventionierung des Niedriglohnsektors durch ein »Grundeinkommen« als Kombilohn.
Wir erinnern uns: Im Bundestagswahlkampf 2005, als allgemein mit einem haushohen Wahlsieg von Angela Merkel und einer Koalition aus Union und FDP gerechnet wurde, hat auch Merkel auf eine pointiert neoliberale Programmatik gesetzt – mit dem »Kirchhofschen Steuermodell« als Applikation der Idee einer flat tax und der »Kopfpauschale« im Gesundheitswesen. Es war die Zeit, als die Telekommunikationsanbieter die Umstellung von getakteten Zeittarifen zur »Flatrate« vollzogen und die »Flatrate« als »innovatives« Modell der Umgestaltung des Steuer- und Sozialsystems galt. Und wir erinnern uns an Merkels versteinerte Miene am Abend der Wahl im September 2005, aus der die Union mit 35 Prozent nicht etwa gestärkt, sondern weiter geschwächt hervorging, überraschend dicht gefolgt von Schröders SPD. Das hat gesessen: Die Flatrate-Flausen fanden in der Bevölkerung keine Zustimmung, und statt der erhofften schwarz-gelben Koalition konnte nur eine fast gleich starke SPD Merkel zur Kanzlerin machen. So verschwanden Kirchhof-Steuer und Kopfpauschale dankenswerterweise in der Versenkung. Auch das neoliberale »Bürgergeld« als Ersatz für bedarfsorientierte Sozialleistungen war Teil dieser »Flatrate«-Ideenwelt, die sich dann schnell überlebt hat: Die Vorschläge von Althaus wurden zwar 2006 noch von der Konrad-Adenauer-Stiftung und der CDU-Grundsatzkommission diskutiert, waren dann aber ebenfalls bald vom Tisch. Dieter Althaus zog sich 2009 aus der Politik zurück, nachdem sein Fehlverhalten beim Skilaufen seine Reputation stark beschädigt hatte.
Für die SPD war Gerhard Schröders »Agenda 2010« ein ähnlich folgenschwerer Sündenfall wie 1914 die Zustimmung zu den Kriegskrediten: Die unter Verweis auf angebliche ökonomische »Notwendigkeiten« vom Kanzler mit »Basta!« durchgesetzten Maßnahmen entfremdeten erhebliche Teile der sozialdemokratischen Mitglieder- und Wählerbasis, die unter »Reformen« etwas ganz anderes verstanden, von der Partei. Mit der vor allem von altgedienten, nunmehr oppositionellen Sozialdemokraten und Gewerkschaftern getragenen »Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit« entstand eine Konkurrenz, die dann durch Vereinigung mit der PDS in eine starke bundesweite Linkspartei einfloss. »Hartz IV« war die Chiffre für soziale Deklassierung. Es bedeutete die Aufkündigung des Aufstiegsversprechens der Sozialdemokratie, von dem jahrzehntelang breite Bevölkerungskreise profitiert hatten: Ältere Facharbeiter und Angestellte, die unverschuldet ihren Arbeitsplatz verloren und auf einem jugendbewegten Arbeitsmarkt unbrauchbar waren, mussten nunmehr ihr über Jahrzehnte erarbeitetes Vermögen aufbrauchen und wurden in Armut gestürzt. Und nicht nur das: Es bestand ein breites Bewusstsein darüber, dass Hartz IV nicht nur für die unmittelbar Betroffenen eine Zumutung war, sondern auch der Schaffung eines großen Niedriglohnsektors diente. Es ging um eine Deregulierung des Arbeitsmarkts, in deren Folge im Prinzip das wiederkehrte, was Karl Kautsky 1892 in seinem Kommentar zum Erfurter Programm der SPD beschrieben hat:
»Die Begriffe Hunger und Lohn schlossen ehedem einander aus. Der freie Arbeiter konnte früher höchstens dann dem Hunger anheimfallen, wenn er keine Arbeit fand. Wer arbeitete, hatte auch zu essen. Der kapitalistischen Produktionsweise gebührt das Verdienst, die beiden Gegensätze Hunger und Lohn miteinander versöhnt und den Hungerlohn zu einer stehenden Einrichtung, ja zu einer Stütze der Gesellschaft gemacht zu haben.«1
Als 2021 mit der Bildung der Ampelkoalition wieder eine von der SPD geführte Regierung entstand, nutzte die Sozialdemokratie die Gelegenheit, sich von ihrem Schröderschen Sündenfall reinzuwaschen. Ein gesetzlicher Mindestlohn, gegen den Kapitalistenverbände und die bürgerlichen Parteien sich lange vehement gewehrt hatten, war immerhin bereits 2015 von der zweiten Großen Koalition unter Merkel eingeführt worden: Nachdem Jahr für Jahr der Deutschen Lieblingsgemüse auf den Feldern zu vergammeln drohte, weil osteuropäische Spargelstecher um das Niedriglohnland Deutschland einen Bogen machten, bestand Handlungsbedarf. Die »Ampel« bot der SPD schließlich den Spielraum, das von ihr selbst eingeführte Konzept »Arbeitslosengeld II« kosmetisch zu revidieren. Die Inflation gab den Anlass zur längst überfälligen Anhebung der Regelsätze, das Schonvermögen, das Leistungsempfängern nicht weggenommen werden darf, wurde für die ersten 12 Monate des Leistungsbezugs erhöht und das Sanktionsregime gemildert. Das Wichtigste aber war die Änderung des Namens: »Hartz IV« sollte durch Umbenennung in »Bürgergeld« entstigmatisiert werden.
Ironischerweise hat die SPD damit ausgerechnet die neoliberale Semantik von Rainer Brüderle und Dieter Althaus übernommen. Ihr großes Problem besteht nun aber darin, dass ihr Bemühen um Wiedergutmachung des zu Beginn des Jahrhunderts von ihr verursachten Schadens ihr nicht gedankt wird. Die Halbierung der Arbeitslosenquote seit 2005 hat bewirkt, dass Arbeitslosigkeit nicht mehr als wesentliches Problem wahrgenommen wird. Helmut Schmidt soll 1972 gesagt haben, fünf Prozent Inflation seien weniger schlimm als fünf Prozent Arbeitslosigkeit – in den letzten Jahren hatten wir beides, und die Arbeitslosigkeit gilt als privates und selbstverschuldetes Problem einer Minderheit. Stattdessen wird über einen tatsächlichen oder vermeintlichen, teils demographisch, teils durch Versagen von Politik und Unternehmen verursachten Arbeitskräftemangel diskutiert.
In dieser Situation fällt der SPD die von ihr gewählte Semantik auf die Füße. Die Wirtschaftsliberalen, die vor zwanzig Jahren unter dem Titel »Bürgergeld« ein als Sozialleistungs-Flatrate sei es bedingt, sei es bedingungslos gezahltes, zum Überleben nicht ausreichendes »Grundeinkommen« diskutierten, wollen davon heute nichts mehr wissen. Dass die SPD ein etwas gemildertes Hartz IV mit der durch den Rückzug der Flatrate-Reformer frei gewordenen Bezeichnung »Bürgergeld« aufhübschte, nährte den Fehlschluss, es ginge dabei vorderhand darum, Arbeitsunwilligen auf Kosten der »Arbeitnehmer« ein leistungslos komfortables Dasein zu ermöglichen. In Wirklichkeit war das »Bürgergeld« zunächst ein Arbeitslosengeld II mit etwas höherem Regelsatz, mehr Schonvermögen und etwas weniger Sanktionsterror. Nichts geändert hat sich daran, dass Leistungsempfänger zu Menschen zweiter Klasse degradiert werden, die auf grundlegende Bürgerrechte wie das Bankgeheimnis oder die Freizügigkeit verzichten müssen, während eine monströse Bürokratie kontrolliert, dass ja niemand einen Euro zu viel auf dem Konto hat. Derweil werden in organisierten Kampagnen fake news verbreitet, wonach man mit Arbeit zum Mindestlohn nicht mehr zum Leben hätte als mit »Bürgergeld«. Und Unionspolitiker fantasieren eine angeblich sechsstellige Zahl von Arbeitsverweigerern zusammen, die es vorzögen, es sich in der »sozialen Hängematte« bequem zu machen, während der reaktionäre Kleinbürgermob, der sich in den Kommentarspalten der Springermedien (und nicht nur dieser) austobt, das Aushungern der Drückeberger verlangt. Ganz so brutal sind Christdemokraten und Liberale natürlich nicht: In ihren Kreisen wird darüber nachgedacht, die gerade erfolgreich an Asylbewerbern erprobte Bezahlkarte demnächst Arbeitslosen zuteil werden zu lassen.
Die Hetze zeigt Wirkung: Die Ampelkoalition hat beim Bürgergeld Verschärfungen beschlossen. Inzwischen sind die Konditionen beim Sanktionsregime und bei der Zumutbarkeit von Fahrtzeiten härter als zuvor bei Hartz IV, die Karenzzeit fürs Schonvermögen wurde halbiert. Nur der beschönigende Name bleibt. Abgesehen vom inflationsbedingt erhöhten Regelsatz ist das »Bürgergeld« inzwischen in mancher Hinsicht schlechter als Hartz IV. Den Rechtspopulisten mit C-Parteibuch reicht das nicht.
Im Mai 2023 starb vereinsamt in einem Hamburger Krankenhaus Arno Dübel, der in den Agenda-Jahren als »Deutschlands frechster Arbeitsloser« (BILD) durch die Talkshows gereicht wurde. Einmal saß er in einer solchen Runde zusammen mit Heiner Geißler, dem CDU-Mann, der weiter links stand als die Schröder-SPD und Hartz IV als Angriff auf die Menschenwürde kritisierte. Geißler bezeichnete Dübels fundamentale Arbeitsverweigerung als »psychisch krank«. Ob Dübel Kriterien einer psychischen Störung erfüllte, sei dahingestellt. Zweifellos wird der größte Teil der psychischen Deformationen unserer Zeit durch das System der Lohnarbeit verursacht, und Menschen, die sich diesem System zu entziehen versuchen, entrichten dafür ihrerseits einen hohen Preis: Man wird dabei kaum seelisch gesund bleiben. Dübel provozierte damit, dass er sich als ohne Arbeit glücklich und zufrieden darstellte. Aber der springende Punkt ist doch: Wer würde denn im Ernst mit ihm tauschen wollen? In Wirklichkeit führte Dübel kettenrauchend ein randständiges und einsames Leben in einer kleinen Stadtwohnung. Das reguläre Renteneintrittsalter hat er nicht sehr lange überlebt. Er mag das als kleineres Übel gegenüber den Zumutungen des normalen Wahnsinns der kapitalistischen Lohnschinderei angesehen haben. »Die Verachtung«, schrieb Felix Bartels in einem Nachruf in der jungen Welt, »galt seiner Klasse, dem Fleiß ohne Glück, der Neid seiner Person, dem Glück ohne Fleiß.«2 Die Hoffnung auf ein Glück ohne Fleiß ist der Daseinsgrund von Lotterien, die an Millionen Lohnabhängige Lose verkaufen. Das Glück des Arno Dübel indes werden nur sehr wenige als erstrebenswertes Lebensmodell sehen. Daran ändert auch die Umbenennung der Stütze in »Bürgergeld« nichts. Wer von all denen, die behaupten, mit Bürgergeld sei man besser dran als mit Arbeit, wäre denn ernsthaft bereit, sich einem entmündigenden Überwachungsregime zu unterwerfen und sich ins soziale Abseits zu begeben? Wer will, dass Geld, das die Tante den Kindern zum Geburtstag schenkt, durchs Jobcenter vom Einkommen abgezogen wird? Und wer hat noch Lust, in der Hoffnung auf Glück ohne Fleiß Lotto zu spielen, wenn den Gewinn das Jobcenter bekommt? Das Leben mit »Bürgergeld« ist von einer selbstbestimmten Lebensführung, wie sie jeder normale Mensch anstrebt, so weit entfernt, dass sich Menschen nur dann freiwillig darauf einlassen werden, wenn das System der Lohnarbeit ihnen keine bessere Alternative bietet: wenn die Alternative »Arbeit« so miserabel ausfällt, dass dem freien Lohnarbeiter seine bürgerliche Freiheit nichts nützt und er die Erniedrigung zum bürokratisch überwachten und schikanierten Leistungsempfänger in Kauf nimmt.
Realistisch ist nach den vorliegenden Daten der Arbeitsagentur von einer geringen zweistelligen Anzahl von Menschen auszugehen, die sich so wie Arno Dübel der Arbeitsvermittlung hartnäckig widersetzen. Von 16 000 Fällen ist die Rede. Plausibel ist, dass hier häufig psychische Problematiken vorliegen. Die Realität ist: Menschen mit niedrigem Bildungsniveau und geringem sozialen Status sind oft nicht in der Lage, sich Hilfe zu holen, sie werden von Psychiatern und Psychologen nicht ernst genommen. Bei der sechsstelligen Anzahl von vermeintlichen »Drückebergern«, die als Sozialschmarotzer diffamiert werden, ist in aller Regel die lange Arbeitslosigkeit nicht durch einen Unwillen zur Arbeit, sondern durch objektive Vermittlungshindernisse verursacht. Vor allem gehören zur Lohnarbeit immer zwei, die im heutigen euphemistischen Sprachgebrauch »Arbeitgeber« und »Arbeitnehmer« heißen. Das System der Lohnarbeit bringt es mit sich, dass nach durch den Markt gesetzten Kriterien zwischen Brauchbaren und Unbrauchbaren unterschieden wird. Alles Gerede über einen Arbeitskräftemangel kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass erstens die Zahl der offenen Stellen im letzten Jahr erheblichen gesunken ist und zweitens Menschen existieren, die einfach kein »Arbeitgeber« haben will. Lange Arbeitslosigkeit, das Alter, gesundheitliche Einschränkungen, familiäre Verpflichtungen, mangelnde Flexibilität oder auch einfach »suspekt« erscheinende Charaktereigenschaften bewirken, dass die Arbeitskraft von Menschen dem Kapital nicht in der verlangten Weise verfügbar ist, nicht berechenbar, nicht belastbar genug, unzuverlässig, so dass kein Unternehmer solche unsicheren Kantonisten haben will.
Diese Menschen, die vom System unbrauchbar gemacht wurden, zu verunglimpfen und ihnen die Schuld an ihrem Scheitern zuzuschreiben, ist Volksverhetzung: Hier ist dem Bundestagsabgeordneten Ates Gürpinar von der Linkspartei uneingeschränkt zuzustimmen. Die LINKE hatte ihren Aufstieg vor allem der Opposition gegen Hartz IV zu verdanken. Sie ist falsch abgebogen, als sie sich Milieus öffnete, denen es nicht um den Kampf gegen die herrschende Klasse, sondern gegen die Mehrheitsgesellschaft geht. Die Folge wird sein, dass die LINKE im nächsten Bundestag aller Voraussicht nach nicht mehr vertreten sein wird. Der Part der sozialen Opposition wird dem Bündnis Sahra Wagenknecht zufallen. Aber völlig unklar ist zur Stunde, ob und wie das BSW diesen Part ausfüllen wird. Unter seinen Mitgliedern sind viele, die vor zwanzig Jahren in der WASG gegen Hartz IV gekämpft haben. Auf der anderen Seite gibt es im BSW nicht nur vom rechten Flügel der SPD stammende bekennende Agenda-2010-Sozialdemokraten, auch Überläufer vom Ost-Realoflügel der Linken outen sich in der neuen Partei als Befürworter des Hartz-IV-Sanktionsregimes. Bei Sahra Wagenknecht selbst ist beim Thema »Bürgergeld« seit geraumer Zeit ein bedenkliches Eiern zu beobachten.
Für Linke wird diese Frage ein wesentlicher Prüfstein für die Haltung zum BSW sein: Denn hier entscheidet sich, ob die neue Partei eine Plattform für eine Politik bietet, die den Antagonismus von Lohnarbeit und Kapital angreift, oder ob sie der von diesem antagonistischen System produzierten Ideologie nachgibt, die die Zumutungen der Lohnarbeit zum Naturgesetz stilisiert und den Kampf gegen die Nutznießer der Ausbeutung durch das Ressentiment gegen die Verlierer ersetzt.
-
Das Erfurter Programm in seinem grundsätzlichen Theil erläutert von Karl Kautsky, 2. Aufl. Stuttgart 1892, S. 37. ↩︎
-
Januskopf des Tages: Arno Dübel, junge Welt vom 25. Mai 2023, https://www.jungewelt.de/artikel/451446.januskopf-des-tages-arno-dübel.html. ↩︎