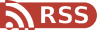Von Burke zu Höcke
In der vergangenen Woche gab Alexander Gauland (83), Mitgründer und Ehrenvorsitzender der AfD, seinen altersbedingten Rückzug aus der Politik bekannt. Die Wendungen seiner Laufbahn vom liberalen CDU-Intellektuellen zum Mentor völkischer Brandstifter geben Rätsel auf.
Mir als Frankfurter war der Name Alexander Gauland schon lange geläufig. Als ich ihn das erste Mal im Zusammenhang mit der AfD hörte, war ich erstaunt: Ich erinnere mich gut an die Jahre um 1990, als Gauland im weit rechts stehenden, von Alfred Dreggers »Stahlhelm-Fraktion« geprägten hessischen Landesverband der CDU als liberaler Vordenker eines modern-aufgeklärten, weltoffenen Konservatismus galt. Seine Karriere war eng verbunden mit der von Walter Wallmann, der 1977 Frankfurter Oberbürgermeister, 1986 Bundesminister für Umwelt und 1987 hessischer Ministerpräsident wurde. Gauland war sein Redenschreiber und Büroleiter und dann Chef der Hessischen Staatskanzlei.
Gauland war damals vor allem ein Mann der Feder, ein zur Differenzierung fähiger Theoretiker, der auch von Linken als Gesprächspartner geschätzt wurde. Seine Bücher habe ich nicht gelesen, aber man bekam über Zeitungen von seiner Publizistik einiges mit. Nichts davon war in irgendeiner Weise rechtsextrem. Im Gegenteil: Gauland verwarf die »falschen deutschen Traditionen« der »Konservativen Revolution«. Die Tradition, auf die er sich berief, war die auf Edmund Burke zurückgehende des moderaten englischen Konservatismus. Englisch geblieben ist bis heute sein Kleidungsstil mit Tweedsakko und Cordhose. Gaulands Ideenwelt beinhaltete eine Skepsis gegenüber einer zu schnellen, außer Kontrolle geratenden Modernisierung, in der auch kapitalismuskritische Töne anklangen. Die Hauptströmung der britischen Tories war seit Disraeli der durchaus auf sozialen Ausgleich bedachte one nation conservatism. Der »Thatcherismus« markierte einen Bruch, für den Gauland keine Sympathien aufbrachte: Noch 2005, als Angela Merkel mit einem um »Kirchhof-Steuer« und »Kopfpauschale« zentrierten neoliberalen Programm Kanzlerkandidatin wurde, bezeichnete er den »Vorbildcharakter der Eisernen Lady« als »zweifelhaft«. Sie habe »das alte Tory-Herz der ›Gentlemen of England‹ zerstört und der Partei statt dessen das kalte Herz des viktorianischen Liberalismus eingesetzt … Englands Größe aber war immer auch sein Pragmatismus, mit Margaret Thatcher ist die erste Ideologin an die Spitze des Staates gelangt.«1
Wie kam es, dass Gauland sich dann in drastischer Skrupellosigkeit radikalisiert hat und selbst vom Pragmatiker zum Ideologen wurde? Seine Enttäuschung über Merkels Kanzlerschaft muss von Anfang an grenzenlos gewesen sein: Auch wenn sie, in die Große Koalition gezwungen, ihr neoliberales Programm schnell beerdigte, war aus seiner Sicht mit ihr die konservative Seele der Christdemokraten verloren. Wahrscheinlich beruhte seine Mutation vom feinsinnigen Intellektuellen zum Einpeitscher des Pöbels auf Frustration darüber, dass ihm in der CDU der große Durchbruch versagt blieb und das alte Bildungsbürgertum, dem er habituell angehörte, keine Rolle mehr spielt. Vermutlich ging es ihm einfach um Rache. Die große Wut auf Merkel hat ihn indes jede Konsistenz verlieren lassen: Der selbsternannte Gentleman im Kostüm eines englischen Landlords gründete die AfD zusammen mit Ökonomen, die jenem kalten Marktradikalismus huldigten, den er immer abgelehnt hat. Als Bernd Lucke Kapitalismuskritik zu den Positionen zählte, für die es in der neuen Partei keinen Platz geben dürfe, konterte Gauland, man müsse darüber doch diskutieren können. Aber er paktierte erst mit Alice Weidel, die ausdrücklich Thatcher als ihr Vorbild bezeichnet, um dann, mit einem jedem Anstand hohnsprechenden Vokabular vom »Entsorgen« missliebiger Migrantinnen bis zur Bagatellisierung des Dritten Reichs als »Vogelschiss«, zum Steigbügelhalter des völkisch-rassistischen Höcke-Flügels zu werden.
Das mag verstehen, wer will: Hinter allem dürfte schlicht Opportunismus stehen. Der geistige Niedergang des Alexander Gauland mag subjektiv eine panische Trotzreaktion sein; objektiv manifestiert sich darin eine Krise des Liberalismus, die weder die Konservativen noch ihre blindlings progressiven Verächter zu bewältigen vermögen.
-
»Margaret Thatcher vor 30 Jahren: Ein Modell für Merkel?« Die Welt vom 12. 2. 2005, https://www.welt.de/print-welt/article424613/Margaret-Thatcher-vor-30-Jahren-Ein-Modell-fuer-Merkel.html. ↩︎