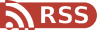Französischer Narodnik
Sein Geburtsdatum ist nicht bekannt, nur das Jahr 1950. Irgendwann im gerade begonnenen Jahr wird er also 75: Jean-Claude Michéa. Der zurückgezogen auf dem Land lebende politische Philosoph gilt als Vordenker der französischen »Gelbwesten«, manche nennen ihn einen »konservativen Anarchisten«. Außerhalb Frankreichs kennt man ihn kaum. Dabei ist er einer der wichtigen links-kommunitaristischen Denker unserer Zeit.
In Frankreich schlug 2007 Michéas luzider Essay über den Liberalismus als »Reich des kleineren Übels« Wellen. Eine deutsche Ausgabe erschien erst 2014 und fand kaum Beachtung. Außer dieser Übersetzung gibt es von ihm und über ihn so gut wie nichts auf Deutsch. So weiß leider hierzulande kaum jemand, dass Michéa lange vor Sahra Wagenknecht – und viel fundierter als sie – die Notwendigkeit eines Bruchs mit jenem Linksliberalismus herausgearbeitet hat, der nach 1990 zur Leitideologie der »neuen Mittelklasse« geworden ist. Michéa gehört selbst nicht zum urban-kosmopolitischen akademischen Jetset. Der Sohn eines kommunistischen Sportjournalisten und Résistance-Kämpfers war Gymnasiallehrer in Montpellier und lebt im Ruhestand auf einem Bauernhof im südwestlichen Département Landes. Er tritt selten öffentlich auf. Wenn, dann gerne im Sowjet-T-Shirt.
Dabei hatte er der Kommunistischen Partei bereits 1976 den Rücken gekehrt. Die Abkehr vom Stalinismus war bei ihm allerdings nicht mit einer Hinwendung zu Linksliberalismus und Sozialdemokratie verbunden. Sondern eine modernekritisch grundierte Radikalisierung, inspiriert von kommunitär-anarchistischen Traditionen, ließ ihn zu einer Art französischem Narodnik werden. Wichtige Bezugspunkte in seinem Denken sind George Orwell sowie der amerikanische Historiker Christopher Lasch, der sich vom Marxisten zum Linkskonservativen wandelte. Michéas beißende Kritik gilt einer Linken, die den Klassenkampf zugunsten der Idee eines abstrakten »Fortschritts« aufgegeben hat.
Es war der Glaube an eherne Notwendigkeiten des »Fortschritts«, der die Revolutionsgeschichte des 20. Jahrhunderts in Modernisierungsdiktaturen einmünden ließ. Es liegt eine tiefe Ironie darin, dass nach 1990 viele ehemalige kommunistische Funktionäre in Osteuropa in ihrer Konversion zum Neoliberalismus den Diskurs der »Notwendigkeit« fortsetzten. Diejenigen, die zuvor Opferbereitschaft zugunsten der lichten Zukunft des Sozialismus predigten, proklamierten nun die Alternativlosigkeit von »Schocktherapien«.
Auch die meisten westeuropäischen Sozialdemokratien wurden vom neoliberalen Sog der sogenannten »notwendigen Reformen« erfasst. Tony Blairs New Labour und Gerhard Schröders »Neue Mitte« standen für eine Neudefinition »linker« Politik, die das Ziel der sozialen Gleichheit aufgab und als Substitut eine »fortschrittliche« Gesellschaftspolitik im Zeichen individualistischer »Selbstbestimmung« und »Diversität« propagierte. Die französischen Sozialisten waren gegenüber der Agenda von Deregulierung, Privatisierung und Entfesselung der Finanzmärkte deutlich reservierter, ihr traditioneller Etatismus behielt bei ihnen eine stärkere Position inne. Aber auch sie übernahmen das »progressive« Wertesystem der Neoliberalen. In ihren Kreisen lautete die typische Argumentation, die überall in Europa links der Sozialdemokratie Schule machte: man müsse den »guten« Gesellschaftsliberalismus – maximale Individualisierung von Lebensstilen und Flexibilisierung sozialer Beziehungen, Überwindung tradierter Normen – vom »schlechten« Wirtschaftsliberalismus trennen.
Michéa machte in links-grünen Kreisen als Spielverderber von sich reden, weil er diese linksliberale Doktrin ihrer Unhaltbarkeit überführte: Wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Liberalismus verhalten sich historisch und logisch komplementär, sie lassen sich nicht konsistent voneinander trennen. Michéa verfolgt die Spur des Liberalismus als Idee eines empire du moindre mal in die Zeit der Glaubenskriege nach der Reformation zurück: Mit der Herausbildung verschiedener christlicher Konfessionen waren in Europa erstmals weltanschauliche Gegensätze entstanden, verbunden mit unterschiedlichen Vorstellungen rechter Lebensführung. Sie waren umkämpft in Kriegen, in denen neuartige Waffensysteme eine ungeheure Zerstörungskraft entfalteten. Der Sehnsucht nach Frieden entsprang die Idee eines weltanschaulich neutralen Staates, der keine Staatsreligion hat und Glaubensinhalte als Privatsache behandelt. Ein Staat, der sich auf keine Wertegemeinschaft mehr stützt, weltanschauliche und moralische Standpunkte einfach ins Ermessen des nutzenmaximierenden Individuums stellt, kann logischerweise dann nur über die neutralen, moralisch indifferenten »technischen« Instanzen Markt und Recht funktionieren. Wirtschafts- und Bürgerrechtsliberalismus sind zwei Seiten einer Medaille. Natürlich ist im 20. Jahrhundert auch ein Linksliberalismus entstanden, der sozialstaatliche Ansrüche rechtlich begründen will: Das war aber nie etwas anderes als eine Optimierung des Kapitalismus. Jeder Linksliberalismus bleibt strukturell den Grundlagen einer Marktgesellschaft verhaftet, seine normativen Zielsetzungen finden in dieser den Rahmen ihrer Realisierung. Die linksliberale Idee der »Selbstverwirklichung« eines abstrakten, traditions-, eigenschafts- und bindungslosen Individuums ist nichts anderes als eine Fetischgestalt der abstrakten Selbstverwertung des Kapitals.
Aufmerksam beobachtete Michéa in den frühen 2000er Jahren die Entwicklung in Deutschland unter der Regierung Schröder, mit der die Post-68er-Bourgeoisie die Macht übernommen hatte. Homo-Ehe und Hartz IV, doppelte Staatsangehörigkeit und Ausdehnung des Niedriglohnsektors – was linke Kritiker an diesem Modernisierungsregime für widersprüchlich hielten, war in Wirklichkeit Politik aus einem Guss. Ihr fundamentales Prinzip ist das Einreißen sittlicher Schranken, die Durchsetzung allgemeiner Flexibilität und Fluidität, um alles dem Verwertungsprozess des Kapitals zugänglich zu machen. Süffisant verwies Michéa darauf, dass die deutschen Rot-Grünen die Prostitution vom Makel der »Sittenwidrigkeit« befreit und zur normalen Gewerbetätigkeit erklärt haben: Die Konsequenz war die, dass arbeitslose Frauen vom Jobcenter zur Aufnahme von Tätigkeiten im Rotlichtgewerbe aufgefordert wurden. Noch nicht so deutlich wie heute war damals, wie sehr dieser Linksliberalismus in seinem Bestreben, tradierte soziale Sittlichkeit zu entwerten und durch ein cultural engineering mit artifiziell konstruierten Sprachregelungen und Verhaltenskodizes zu ersetzen, zum Autoritarismus tendiert. Paternalistische Links-Autoritarismen »liberaler« wie »konservativer« Ausrichtung lehnt Michéa gleichermaßen ab.
Die »Linke«, wie wir sie heute kennen, entstand im späten 19. Jahrhundert aus einem Zweckbündnis der Arbeiterbewegung mit dem bürgerlichen Linksliberalismus und Progressismus, die ein gemeinsames Interesse an der Abwehr reaktionärer Tendenzen (Bismarcks »konservative Wende« in Deutschland, die Dreyfus-Affäre in Frankreich) verband. Noch Rosa Luxemburg legte großen Wert darauf, die revolutionäre Sozialdemokratie von der bürgerlichen Linken strikt zu unterscheiden: In ihren Augen rechtfertigte die taktische Allianz keine inhaltliche Angleichung. Dennoch kam es im Laufe des 20. Jahrhunderts durch die Öffnung sozialistischer Parteien für die progressive Intelligenz zu einer wachsenden Verschmelzung. Solange eine starke Arbeiterbewegung mit schlagkräftigen Gewerkschaften existierte, vermochte sie dem linken Spektrum ihren Stempel aufzudrücken. Im ausgehenden 20. Jahrhundert hat jedoch der Rückgang der organisierten Arbeiterbewegung dazu geführt, dass die »Linke« sich zu dem zurückentwickelt hat, was sie ursprünglich im 19. Jahrhundert war: eine von gebildeten urbanen Milieus getragene Kraft der bürgerlichen Modernisierung, die für die Arbeiterschaft unattraktiv ist. Michéas hartes Urteil lautet: Eine Linke, die das ökonomische, politische und kulturelle Programm des Liberalismus übernommen hat, die nicht mehr gegen das System der Kapitalakkumulation, sondern nur noch gegen »Diskriminierungen« kämpft und mit »inklusiver Sprache« und veganer Ernährung die Welt verbessern will, ist »objektiv konterrevolutionär« geworden.
Michéa plädiert nachdrücklich für eine kommunitaristische, populäre Linke, die sich nicht der Dominanz des linksliberalen Progressismus unterwirft, sondern den Klassenkampf gestützt auf die Gemeinschaftswerte der Subalternen führt. In der Gelbwestenbewegung von 2018 haben seine Ideen politisch Gestalt angenommen: die Wiederkehr des »Volkes« in der Revolte der Unterschicht, der Landbevölkerung, der Arbeiter, Bauern und Handwerker gegen die städtische herrschende Klasse und ihre Sozialingenieure, der Peripherie gegen das Zentrum der Macht.