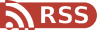Antimodern in Wort und Ton
Viele Jahre war Hilarion Alfejew das vorzeigbarste Gesicht der russisch-orthodoxen Kirche: Der gebildete und polyglotte Kleriker mit Doktortiteln renommierter Unversitäten, nebenbei auch als Komponist sakraler Musik bekannt, war für die Außenbeziehungen des Moskauer Patriarchats zuständig. Im Sommer 2022 wurde er jedoch degradiert, nach Ungarn versetzt und Ende 2024 in den vorzeitigen Ruhestand entlassen. Die Gründe für das Karriereaus haben es in sich.
In Russland gibt es die alte Vorstellung von Moskau als dem »Dritten Rom«: Nach dem Untergang des Byzantinischen Reichs im Jahr 1453, dessen griechisch-orthodoxe Einwohner sich selbst »Römer« nannten, nahm Russland das Erbe Roms für sich in Anspruch. Die Vorstellung von Russland als Bewahrer der Tradition Europas prägte das Selbstverständnis der Sowjetunion als Fortsetzerin der fortschrittlichen Ideen von Humanismus und Aufklärung, Putins Imperium hingegen sieht sich selbst als Bastion der konservativen Werte des christlichen Europa, die der dekadente Westen verraten habe.
Der 1966 geborene Grigori Walerjewitsch Alfejew, besser bekannt unter seinem Priesternamen Hilarion, trat zunächst als musikalisches Talent in Erscheinung. Seine Studienzeit fiel in die Perestroika-Jahre: Am Moskauer Konservatorium ließ er sich in den Fächern Klavier, Violine und Komposition ausbilden, dann schlug er die geistliche Laufbahn ein, studierte Theologie und Philosophie in Moskau, Oxford und Paris und übte Lehrtätigkeiten in Homiletik, Dogmatik und Griechisch aus. Seine guten Sprachkenntnisse prädestinierten ihn für den Einsatz in russisch-orthodoxen Auslandskirchen, einige Jahre diente er als Bischof in Wien. Schließlich wurde er zum Metropoliten von Wolokamsk und Leiter des Außenamts des Moskauer Patriarchats ernannt. Parallel setzte er seine akademische Karriere in der Schweiz fort: Die Universität Fribourg, wo er sich 2005 habilitiert hatte, verlieh ihm eine Titularprofessur, die ihm im März 2022 wegen mangelnder Distanzierung von Putin entzogen wurde.
Eher moderat, nicht klösterlich
Aber auch in Moskau sank plötzlich sein Stern. Von seinen Kirchenämtern wurde er im Juni 2022 unehrenhaft entbunden und wieder in die Diaspora geschickt, diesmal nach Budapest. Als Grund vermutete man interne Kritik an der »Spezialoperation« in der Ukraine. Gegen die vom Patriarchen von Konstantinopel unterstützten Sezessionsbestrebungen der ukrainisch-orthodoxen Kirche hatte Hilarion zuvor heftig opponiert, aber nach der vom Moskauer Kirchenoberhaupt Kyrill begeistert begrüßten Invasion verhielt er sich auffällig still. In Ungarn beklagte er, dass Russland in Gewalt versinkt.
Generell war Alfejew als für russische Verhältnisse eher moderat einzuschätzen: Man ging davon aus, dass sein langer Aufenthalt in westlichen Ländern eine relativ weltoffene Einstellung begünstigt hat. Er hat für Impfungen gegen Covid geworben, die von Fundamentalisten als Teufelswerk abgelehnt werden. Jedoch ist die russisch-orthodoxe Kirche insgesamt eine uns fremde Welt. Kirchenpolitisch trat Hilarion für eine engere Zusammenarbeit mit Katholiken ein, die aus orthodoxer Sicht als abtrünnige Brüder und Schwestern gelten. Dabei sind den Ostkirchen die geringen dogmatischen Unterschiede gar nicht so wichtig. Das Problem ist ein kulturelles: Die westliche katholische Kirche erscheint den Orthodoxen viel zu protestantisch-liberal-modernistisch zersetzt. Sie werfen den Katholiken vor, dass sie an ihre eigenen Dogmen nicht mehr glauben. Dennoch pflegte Hilarion ein gutes Verhältnis zu Papst Franziskus. Kompromisslos war indes seine Haltung zu Protestanten: Evangelische Kirchen, wo jeder glauben darf, was er will, Frauen und Schwule Pfarrer werden können und gleichgeschlechtliche Ehen gesegnet werden, sind ja aus orthodoxer Sicht überhaupt keine Kirchen. Als 2009 Margot Käßmann Ratsvorsitzende der EKD wurde, brach Alfejew die Beziehungen ab.
Umso größer war der Skandal, als im Juli 2024 sein junger Budapester Assistent ihm sexuelle Übergriffe vorwarf. Überhaupt soll Alfejews Lebensstil vom klösterlichen Ideal der Orthodoxie weit entfernt gewesen sein: Von üppigem Luxus und Verschwendung von Spendengeldern war die Rede. Zunächst wurde erwogen, ihn ins tschechische Karlsbad auf eine Stelle als einfacher Pfarrer zu versetzen, die frei geworden war, als der dortige Priester im Zuge der antirussischen Hysterie des Landes verwiesen wurde. Die Vorwürfe erwiesen sich dann aber als so gravierend, dass Alfejew in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wurde. Peinlicher hätte es nicht kommen können für eine Kirche, die sich als Bollwerk gegen westliche Dekadenz, Materialismus und Konsumgesellschaft sieht.
Neben seiner Tätigkeit als Kirchenmann hat Hilarion sich kontinuierlich dem Komponieren geistlicher Musik gewidmet. Ein Werk von ihm sagt mehr als tausend Worte: Da offenbart sich eine Klangwelt, die von der Moderne völlig unberührt ist.
Wohlklingende Simplizität
In der orthodoxen Liturgie ist Instrumentalmusik nicht gestattet. Die »typisch russische« Tradition des kirchlichen Chorgesangs entstand erst im 19. Jahrhundert unter westlichem Einfluss, als Mehrstimmigkeit die alten byzantinischen Hymnen ablöste. Für den Konzertsaal schrieb Hilarion Alfejew hauptsächlich Werke für Chor und Orchester, in denen er diesen russischen Kirchenmusikstil mit Elementen der Frühromantik kombiniert.
In der evangelischen Kirche, deren Geist maßgeblich die westliche Neuzeit geprägt hat, ist der Karfreitag der höchste Feiertag. Für ihn komponierte der Lutheraner Johann Sebastian Bach seine umfangreichsten Werke. Für die Orthodoxen hat die Leidensgeschichte keine vergleichbare Bedeutung. Wenn ein orthodoxer Kleriker eine Matthäuspassion schreibt, ist das insofern erstaunlich. Wer solches tut, weiß auf jeden Fall, woran er sich messen lassen muss: Alfejews kirchenslawische Passion entstand sicher aus dem Ehrgeiz, eine Art orthodoxes Pendant zu Bach zu schaffen.
Das Ergebnis ist Edelkitsch von erlesener Dürftigkeit, die als Tiefsinn verkauft wird. Wir hören zwei Stunden lang eine Mischung aus russischem Chorgesang und monotonen Rezitationen mit einem seichten Abguss von Mendelssohn und Spohr. Endlose Orgelpunkte und Fugen, die jeder Kompositionsschüler im zweiten Semester hinbekommt, sorgen für Langeweile. Nichts in dieser akustischen Parallelwelt erinnert daran, dass es einmal eine russische Moderne gab. In den Kundenrezensionen bei einem bekannten Online-Händler erntet Alfejews Großwerk Beifall: Es scheint auch im Westen Menschen anzusprechen, denen die Komplexität und Gebrochenheit der Moderne ein Gräuel ist und die Hilarions wohlklingende Simplizität für tiefgründig halten.
Was sich hier als orthodoxe Spiritualität gebärdet, ist aber einfach schlecht komponiert. Mit seiner theologischen und musikalischen Doppelbegabung führt Hilarion Alfejew in Wort und Ton einen Kampf gegen die Moderne, der sich zumindest auf der musikalischen Seite als Luftnummer erweist.
Bishop Hilarion Alfeyev: St Matthew Passion. Protodeacon Viktor Shilovsky (Evangelist, baritone), Olga Shalayeva (soprano), Irina Romishevskaya (mezzo-soprano), Andrey Nemzer (tenor), Alexey Tikhomirov (bass), Choir of the State Tretyakov Gallery, Tchaikovsky Symphony Orchestra of Moscow Radio / Vladimir Fedosseyev. RELIEF CR 991094 (2 CD)