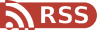Stiller Feiertag
Die gesetzlichen Regelungen über Feiertage sind in Deutschland generell Ländersache, mit Ausnahme des Tags der Deutschen Einheit, der als Nationalfeiertag bundeseinheitlich festgeschrieben ist. Was aber ist ein »Feiertag«? Der liberale säkulare Staat kann im strengen Sinne seinen Bürgern nicht vorschreiben, was sie feiern sollen. Im rechtlichen Sinne sind Feiertage negativ bestimmt als »Ruhetage«, an denen nicht gearbeitet wird – mit Ausnahme der Bereiche, wo es zwingend erforderlich ist –, wobei davon ausgegangen wird, dass an diesen Tagen eine kulturelle Tradition der Arbeit und Geschäftstätigkeit entgegensteht. Das sind in Deutschland überwiegend Festtage des Christentums. Die Autonomie der Länder ermöglicht die Anpassung an konfessionelle Besonderheiten. Dass die Hochfeste Weihnachten, Ostern und Pfingsten arbeitsfrei sind, gilt als Selbstverständlichkeit, obwohl immer weniger Leute die Frage, was Ostern und was Pfingsten ist, beantworten können. (Aber wenn im Handel Schokoladenosterhasen unter der Bezeichnung »Sitzhase« geführt werden, halluziniert die rechte Kulturkampffront eine Zerstörung des christlichen Abendlands durch die linksgrüne Islamisierung.)
Für einige Feiertage sehen die Gesetzgebungen weitere Reglementierungen vor: Der Karfreitag ist einer der »stillen Feiertage«, an denen Vergnügungsveranstaltungen untersagt sind. Unseren Liberalen und Progressiven ist das ein Dorn im Auge. Ihr Argument lautet: Christen, die den Karfreitag als Tag der Trauer mit Fasten und Abstinenz begehen wollen, können das ja gerne tun, aber sie sollen sich doch bitte nicht anmaßen, Andersdenkende, die lieber tanzen gehen oder sich besaufen wollen, daran zu hindern. Dieses liberale Argument hat jedoch einen Haken: Mit ihm kann nicht mehr begründet werden, wieso denn überhaupt dieser Tag ein arbeitsfreier Ruhetag sein soll, an dem man nach persönlichem Gusto in die Kirche gehen, drei Stunden lang die Matthäuspassion hören oder, nach dem Willen der »Progressiven«, sich alternativ auf dem Dancefloor delektieren können soll. Für die meisten Deutschen ist der Karfreitag de facto sicher nichts weiter als ein verlängertes Wochenende: Aber wer von dessen Daseinsgrund nichts wissen will, kann es nicht rechtfertigen.
Der Status des Karfreitags als gesetzlicher Feiertag in ganz Deutschland ist an sich keineswegs selbstverständlich: Er ist strenggenommen ein protestantischer Feiertag. In katholisch geprägten Ländern wie Österreich oder Italien ist er ein gewöhnlicher Arbeitstag. Im Katholizismus hat er nicht die herausgehobene Bedeutung, die erst die Reformation ihm verliehen hat: Er ist bloß der Prolog zu Ostern. In katholischen Kirchen findet die Kreuzwegandacht üblicherweise abends statt: Wer tagsüber arbeitet, kann sie besuchen. Die evangelische Theologie hat den Tag, an dem Christus am Kreuz erhöht ist und alle an sich zieht, zum höchsten Feiertag erhoben. Seine Universalisierung findet ihren Widerhall in Hegels Rede vom »spekulativen Karfreitag«, aus dessen »Härte allein … die höchste Totalität in ihrem ganzen Ernst und aus ihrem tiefsten Grunde, zugleich allumfassend und in die heiterste Freiheit ihrer Gestalt auferstehen kann und muß.«1 Im konfessionell gemischten Deutschland hat der Protestantismus dem Karfreitag übergreifend eine Schwerkraft verliehen, die auch die katholischen Regionen erfasst hat. Selbstverständlich war der Karfreitag auch in der atheistischen DDR, deren Territorium das historische Kerngebiet der Reformation zugefallen ist, ein gesetzlicher Feiertag. Im Fernsehprogramm DDR 2 gab es am Karfreitag immer die Matthäus- oder Johannespassion von Bach mit dem Thomanerchor.
Mit der Stille des Karfreitags verhielt es sich allerdings trickreicher. In der katholischen Liturgie schweigt traditionell die Orgel, die erst in der Osternacht wieder erklingt. Die Reformation hat diese Tradition zunächst fortgesetzt. Im 17. Jahrhundert wurde in den lutherischen Gemeinden das Verbot der Instrumentalmusik nach und nach aufgehoben: Wenn der Karfreitag der höchste Feiertag ist, dann verdient er eine künstlerisch entsprechend hervorgehobene Gestaltung. Das Genre der Passionsmusik, zu dem Bach seine Gipfelwerke beisteuerte, blieb aber umstritten: Schon im frühen 18. Jahrhundert hatten manche Theologen Bedenken dagegen, dass die Leute bloß der Musik wegen in die Kirche gehen. In Leipzig, Hochburg der konservativen Luther-Orthodoxie, hielt die Kirchenleitung bis 1720 an der traditionellen stillen Liturgie nur mit Lesungen, Chorälen und Motetten ohne Orgel fest. Allerdings gab es Konkurrenz: In der kleineren, Ende des 17. Jahrhunderts erbauten Neukírche (im Zweiten Weltkrieg zerstört) brachte das von Georg Philipp Telemann während seiner Leipziger Studienjahre gegründete Collegium musicum neue Kirchenmusik zu Gehör, die auf starkes Interesse stieß. 1717 machte eine Aufführung eines Passionsoratoriums von Telemann (der 1712 nach Frankfurt gewechselt war) Furore, sehr zum Verdruss des altmodisch eingestellten Thomaskantors Kuhnau, der sich über den »opernhaften« Stil empörte. Aber man musste mit der Zeit gehen und einigte sich auf einen Kompromiss: 1721 ermöglichte die Stiftung einer reichen Witwe die parallele Durchführung zweier Vespergottesdienste in der Thomas- und Nikolaikirche, einer traditionell und einer mit Passionsmusik, Kuhnau selbst komponierte eine Markuspassion, die leider verschollen ist. Als 1723 Bach zum Nachfolger des verstorbenen Kuhnau bestellt wurde, musste er sich vertraglich verpflichten, dass seine Musik nicht »zu lang währen« und nicht »opernhaftig herauskommen« soll, aber er interpretierte die Klausel auf seine eigene Weise und schuf die Werke, die ihn posthum zum »fünften Evangelisten« eines säkularen Zeitalters werden ließen. In der Karwoche 1870 hörte Nietzsche als einer, der »das Christentum völlig verlernt hat«, die Matthäuspassion mit dem »Gefühl der unermesslichen Verwunderung«.
Nietzsches unermessliche Verwunderung findet ihren Raum aber nur da, wo die Bezüge zu der Tradition, an der sie sich entzündet, nicht gekappt werden. Auch Hegels spekulativer Karfreitag braucht institutionelle Garantien.
-
Hegel: Glauben und Wissen. Werke (Red. Moldenhauer/Michel), Band 2, Frankfurt a.M. 1979, S. 432f. ↩︎